 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Die Weisheit des Kirchenrechts darf nicht übergangen werden!4. Mai 2010 in Aktuelles, 17 Lesermeinungen Ein Kath.Net-Kommentar anlässlich des jüngsten Urteils des Verwaltungsgerichts Mannheim in der Causa Zapp - Von Dr. Christian Spaemann München (kath.net) Denn ob jemand als zur Kirche gehörig anzusehen ist oder nicht, ist eine Frage, die allein die Kirche selber entscheiden muss. Die Katholische Kirche in Deutschland dürfte tatsächlich kirchenrechtlich gesehen um einiges größer sein als sie selber meint und das darf ihr nicht egal sein, wenn Sie an dem Heil jedes einzelnen interessiert ist. Denn ein vier Jahre altes, von Papst Benedikt XVI. approbiertes Schreiben des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte harrt immer noch seiner Umsetzung. Es verbietet das, was in deutschen Landen nach wie vor Tag für Tag geschieht, nämlich Katholiken automatisch von der Gemeinschaft der Gläubigen auszuschließen, das heißt zu exkommunizieren, die vor einer staatlichen Behörde ihren Austritt aus der Kirche erklären. Erst müssten die Austrittsmotive der betreffenden gegenüber einer kirchlichen Autorität bekundet und von dieser geprüft und angenommen werden. Nur solche Motive, die den Abfall vom Glauben umfassen oder den Willen beinhalten, sich von der Gemeinschaft der Gläubigen zu trennen, werden von Rom als Exkommunikationsgrund akzeptiert. Der anonyme Austritt vor einer staatlichen Behörde wird in den 2006 veröffentlichten Normen ausdrücklich ausgeschlossen, er darf nicht als Exkommunikation gewertet werden. Das heißt, dass der Wunsch, keine oder weniger Kirchensteuer zu zahlen oder den Unmut über Missstände in der Kirche zum Ausdruck zu bringen, kirchenrechtlich nicht ausreichend für eine Exkommunikation ist. Wer heute der katholischen Kirche in Deutschland angehört und einkommensteuerpflichtig ist, zahlt automatisch Kirchensteuer. Diese wird von der Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts in Kooperation mit dem Staat erhoben, was bedeutsame Konsequenzen hat. Denn wer keine oder weniger Kirchensteuer zahlen will, muss vor der staatlichen Behörde seinen Körperschaftsaustritt erklären. Dieser wird nach wie vor an die kirchliche Autorität weitergeleitet, ins Taufbuch eingetragen und als Exkommunikation gewertet. Die deutschen Bischöfe hatten vor vier Jahren, kurz nach der Veröffentlichung des päpstlichen Schreibens erklärt, dass die römischen Normen »nicht die in der deutschen Rechtstradition stehende staatliche Regelung für den Kirchenaustritt« betreffen. Dabei bezog sich das Schreiben aus Rom in erster Linie auf die deutschsprachigen Länder. Dies veranlasste denn auch den emeritierten Freiburger Kirchenrechtler Hartmut Zapp dazu, einen Präzedenzfall zu schaffen. Um auf die ungeklärte kirchenrechtliche Situation in der Bundesrepublik hinzuweisen, trat er ein Jahr nach dem vatikanischen Schreiben vor seiner Heimatbehörde aus der katholischen Kirche aus. Gleichzeitig gab Zapp der Kirchenbehörde bekannt, dass sein Kirchenaustritt keineswegs als ein Verlassen der Kirche im kirchenrechtlichen Sinne zu verstehen sei, sondern nur als ein Austritt aus der Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts. Um dies zu dokumentieren, hatte er auf seinem offiziellen Austrittsformular die Bezeichnung der Religionsgemeinschaft "römisch-katholisch" um den Begriff Körperschaft des öffentlichen Rechts ergänzt. Dieser vermeintlich gesetzwidrige Zusatz hat zu einem Rechtsstreit zwischen der Erzdiözese Freiburg und der Behörde geführt, der im jüngsten Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim sein vorläufiges Ende gefunden hat. Der Austritt Zapps wurde als nicht gültig zurückgewiesen. Im vorangegangenen Urteil der Verwaltungsgerichts Freiburg hieß es noch, dass der Zusatz lediglich die römisch-katholische Kirche in ihrer korrekten, vollständigen Bezeichnung, die ihr staatskirchenrechtlich zukomme beinhalte und daher keine unzulässige Hinzufügung im Sinne des Kirchensteuergesetzes sei. Es bleibt nun offen, ob Zapp noch einmal ohne den umstrittenen Zusatz auf dem Formular aus der Kirche austritt, um anschließend an kirchlicher Stelle in Rom mit dem Ziel weiter Klage zu führen, den Eintrag in sein Taufbuch zu verhindern oder ob der Streit am Verwaltungsgerichtshof in Leipzig weitergeführt wird. Fest steht: Das Mannheimer Urteil ändert in keiner Weise die kirchenrechtlich ungeklärte Situation in der Bundesrepublik. In jedem Fall wird dieser Präzedenzfall seitens der deutschen Bischöfe nicht auf Dauer übergangen werden können. Noch ist die Mehrheit der Bischöfe der Überzeugung, es gebe eine Identität zwischen der Kirche als sakramental verfasster Gemeinschaft und der Kirche Wie sollten sie auch? Die Kirche in Deutschland hat die Rechtsform einer Körperschaft ja nur angenommen, um als Teilkirche der universalen Kirche in diesem Land gesellschaftlich agieren zu können. In ihrer Einschätzung schützen die römischen Anordnungen diese sakramental-amtliche Verfassung der katholischen Kirche vor deren Aushöhlung: Der Abfall von der Kirchengemeinschaft als eine Handlung, die seitens der Kirche als Exkommunikation gewertet wird, kann demnach eben nicht anonym vor einer staatlichen Behörde, sondern nur gegenüber einer kirchlichen Autorität geschehen und muss von dieser geprüft werden. Nach Auffassung der deutschen Bischöfe bekundet jeder, der vor der staatlichen Behörde austritt, seinen Willen, sich von der Kirche zu trennen, und erfüllt durch diesen vermeintlich schismatischen Akt die kirchenrechtlichen Voraussetzungen für eine Exkommunikation. Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller geht sogar soweit, zu behaupten, dass jeder Austretende mit dem Glauben und der Kirche nichts mehr zu tun haben wolle. Andere Motive, als der Wunsch sich von der Kirche des lebendigen Gottes öffentlich loszusagen könnten hierfür kein Grund sein. Daher sei eine weitere Teilnahme an der sakramentalen Gemeinschaft mit Christus nicht möglich. Aber stimmt das? Kann man tatsächlich sagen, dass alle Menschen, die aus der Kirche austreten, mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben wollen? Gilt das auch für jene junge Frau, die vom niederbayrischen Bauernhof ihrer Eltern nach München zieht und, um Geld zu sparen, aus der Kirche austritt, aber nach wie vor in ihrer Wohnung ein Kreuz hängen hat und zu Weihnachten und Ostern in die Kirche geht? Kann man sich sicher sein, dass derjenige, der aus Ärger über seinen Pfarrer oder im Rahmen aktuellen Missbrauchsdiskussion aus der Kirche austritt, dennoch seine Kinder katholisch erzieht und mit Ihnen die christlichen Feste feiert, mit dieser nichts mehr zu tun haben will? Wie kommt man zu der Vorstellung, dass der regelmäßige Anstieg der Austritte bei Steuererhöhungen und in Zeiten der Wirtschaftskrise vorrangig auf Apostasie, Häresie oder schismatische Absichten der Betreffenden zurückzuführen sei? Hat sich hier nicht ein einseitiges, rationalistisches Menschenbild in die Kirche eingeschlichen? Geht man von dem psychologischen Faktum aus, dass der Glaube nicht nur den Verstand betrifft, der Mensch viel mehr in einer komplexen, in vielen Bereichen unbewussten Weise mit ihm verbunden ist, dann kann der Akt des Kirchenaustritts sehr wohl aus anderen Motivationen erfolgen als der des Bruchs mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Dann kann er sich nur auf einzelne Aspekte der Kirche beziehen, die für den Betroffenen im Vordergrund seines Bewusstseins stehen. Viele in ihrem Glauben vielleicht nicht so gefestigte Menschen wollen keine Kirchensteuer mehr zahlen, weil sie z. B. einer kirchenkritischen Atmosphäre in der Arbeit und in den Medien ausgesetzt und davon beeinflusst sind. Sie haben dabei nur bestimmte institutionelle Aspekte der Kirche im Auge, bleiben aber weiter gläubig. Die Möglichkeit des rein formal administrativen Austritts aus der Kirche ohne Hinterfragung der Motive der Betroffenen stellt geradezu eine Leimrute aus der Kirche heraus dar. Entspricht dies der Mentalität Jesu, der immer Verständnis für die Kleinen und Schwachen gefordert und diejenigen ermahnt hat, die ihnen Anlass zur Sünde, also zur Absonderung gegeben haben? Durch die eiserne Verknüpfung der Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft mit dem Kirchenbeitrag stellt sich die katholische Kirche in Deutschland den Menschen wie ein Verein dar und mutet ihnen dabei zu, dahinter die eigentliche Kirche als sakramentale Gemeinschaft in Christus zu sehen. Ein hehrer Anspruch, der wenig mit der komplexen Realität vieler Gläubiger zu tun hat. Es sei unbestritten, dass es zur Christenpflicht gehört, einen materiellen Beitrag zum Leben der Kirche und für caritative Zwecke zu leisten. Es ist daher auch das Recht der Kirche, die Verweigerung solch eines Beitrags grundsätzlich als Sünde zu definieren und ggf. zu sanktionieren. Die Exkommunikation allerdings ist im Kirchenrecht klar definiert und kommt für diesen Tatbestand nicht in Frage. Alle Gläubigen, die den Kirchenbeitrag verweigern oder reduzieren wollen, ausnahmslos zu exkommunizieren, ist kirchenrechtlich gesehen unverhältnismäßig und stellt an sich schon eine Versuchung für viele Gläubigen dar, tatsächlich mit der Kirche zu brechen. Der Zweck, ein gewünschtes Kirchensteueraufkommen zu erzielen, heiligt nicht die Mittel. Aus dieser Perspektive besehen wird die Kirche nicht einfach von den Austretenden passiv verlassen, sondern schließt diese aktiv aus. Zumindest formal betrachtet sind die Verantwortlichen für dieses System auch Täter, genauso wie die Pfarrer, die den Eintrag in das Taufbuch vornehmen, ohne die Motive des Austretenden geprüft zu haben. Auch die Erkenntnis der Soziologie, dass Exklusion immer die Tendenz zur Inklusion induziert, sollte uns alle nachdenklich machen. Auf die Kirche angewandt heißt dies, dass die Exkommunikation mit hoher Wahrscheinlichkeit all jene psychischen Mechanismen begünstigt, die zum Aufbau einer gegen die Kirche gerichteten Identität führen. Der Vermerk Ausgetreten im Taufbuch ist etwas für jeden Betroffenen sehr Eindrückliches. Niemand weiß, wie vielen Menschen durch diesen Eintrag Unrecht geschehen ist und welche Verbitterung er möglicherweise bewirkt oder verstärkt hat. Viele fühlen sich durch die von ihnen gar nicht intendierte Exkommunikation erst wirklich von der Kirche getrennt und entfernen sich dann tatsächlich weiter von ihr. Könnte die Exkommunikation nicht eine Entfremdung des Betroffenen in seiner persönlichen Beziehung zu Gott bewirken? Wer will dafür die Verantwortung übernehmen? Halten die deutschen Bischöfe es für gerecht, dass Menschen, die nie der Kirche gegenüber ihren Abfall vom Glauben bekundet haben, exkommuniziert sein sollen, während Theologen, die eindeutige Häresien vertreten und so tatsächlich die kirchenrechtlichen Voraussetzungen für eine Exkommunikation erfüllen, sich um ihre kirchliche Stellung keine Sorgen machen müssen? Eigentlich müsste jeden Seelsorger die Frage umtreiben, wie er es vermeiden kann, dass Menschen aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden, obwohl sie der Kirche gegenüber nie ihren Abfall vom Glauben bekundet haben. Eigentlich müssten die deutschen Bischöfe darum ringen, dass der automatische Zusammenhang von Körperschaftsaustritt vor einer staatlichen Behörde und vermeintlicher Exkommunikation gelöst wird. Unwürdig ist jedenfalls ist das halbherzige Lavieren in der Kirche. Als es um die Versöhnung des Vatikans mit den Pius-Brüdern ging, erklärte Kardinal Lehmann die Exkommunikation zu etwas Veraltetem. Gleichzeitig blieb es bei der Massenexkommunikation all jener, die keine Kirchensteuer zahlen wollen. Man legte sich die Sache zurecht, wie es einem passte. So produziert die katholische Kirche in der Bundesrepublik selber jene Austrittszahlen, bei deren Anblick sie wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt. Aber es geht nicht einfach um höhere Mitgliederzahlen, es geht auch nicht nur um Rechte, die den Gläubigen zustehen. Bei genauem Hinsehen geht es um den Grundauftrag der Kirche: das Heil jedes einzelnen Menschen, seine persönliche Verbindung zum lebendigen Gott, eine Verbindung, für die die Kirche vom Sohn Gottes einen Vermittlungsauftrag erhalten hat. Mögen die deutschen Bischöfe sich von diesen pastoralen Aspekten erweichen lassen! Noch hätten sie die Chance, die römischen Anordnungen ohne Gesichtsverlust umzusetzen und die hinter der Idee der Kirchensteuer stehende pastorale Weisheit positiv nach außen zu vertreten. Ein möglicher finanzieller Schaden sollte nicht das Vertrauen auf die positiven Folgen erschüttern, die zu erwarten sind, wenn man sich der mit unserem Kirchensteuersystem verbundenen komplexen persönlichen Situation der Gläubigen stellt. Andernorts geht es ja auch. So stellten die österreichischen Bischöfe bereits im März 2007 das römische Schreiben auf ihre Homepage und bemühten sich, durch eine pastorale Initiative die Praxis des Kirchenaustritts den Intentionen des Kirchenrechts anzunähern. In der Schweiz erließ das Bistum Chur im Sommer 2009 sogar neue Richtlinien für den Kirchenaustritt, darin heißt es: Solange der Personenstand von Gläubigen »nicht durch Apostasie, Häresie oder Schisma verändert wird«, darf im Zusammenhang mit dem Austritt »kein Eintrag in das Taufbuch vorgenommen werden«. Außerdem wurde ein Fonds geschaffen, an den jene Katholiken, die ausgetreten sind, aber katholisch bleiben wollen, einen Solidaritätsbeitrag entrichten können. Jedem deutschen Bischof stünde es frei, die Praxis des Bistums Chur zu übernehmen. Jeder Pfarrer hätte die Möglichkeit, mit Berufung auf sein Gewissen und auf die Normen aus Rom den Eintrag in das Taufbuch abzulehnen. Doch wer hat den Mut? Diskutiert werden muss auch die Frage einer Wiedergutmachung, und zwar denjenigen gegenüber, in deren Taufbuch die Exkommunikation ohne Prüfung der Motive eingetragen wurde. Zumindest müsste man die Möglichkeit einer rückwirkenden Löschung in Erwägung ziehen. Denn gerade in der Kirche kann kein anderes Rechtsprinzip gelten als: in dubio pro reo.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuKirchensteuer
|       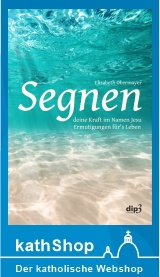 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
