 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Das Päpstliche Staatssekretariat vatikanisches 'Superministerium'5. September 2013 in Chronik, keine Lesermeinung Der Posten des Kardinalstaatssekretärs ist einer der Schlüsselposten an der Römischen Kurie; die Umsetzung der (Kirchen-)Politik des Heiligen Vaters ist von diesem Amte wesentlich abhängig. Von Ulrich Nersinger Rom (kath.net/un) Zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden aus der Notwendigkeit einer häufigeren, raschen und geheimen Erledigung der päpstlichen Korrespondenz neben der Apostolischen Kanzlei neue Behörden, wie die Camera Secreta und die Secretaria Apostolica für die amtliche Korrespondenz in lateinischer Sprache. Apostolische Sekretäre sind schon seit dem Pontifikat Benedikts XII. (Jacques Fournier, 1334-1342) nachweisbar; sie arbeiteten diplomatische Schreiben aus und expedierten diese unter Umgehung der Apostolischen Kanzlei. Die Camera Secreta nahm unter Martin V. (Oddone Colonna, 1417-1431) eine rechtliche Ausprägung an. Die Secretaria Apostolica erhielt von Innozenz VIII. (Giovanni Battista Cibo, 1484-1492) mit der Apostolischen Konstitution Non debet reprehensibile vom 31. Dezember 1487 ihre Ordnung; sie bestand aus vierundzwanzig Apostolischen Sekretären, von denen einer, Secretarius domesticus genannt, den Vorsitz führte. Auf diese Secretaria Apostolica gehen die Kanzlei für die Breven, das Sekretariat für die Breven an die Fürsten und das Sekretariat für die Lateinischen Breven zurück. Unter Papst Leo X. (Giovanni de Medici, 1513-1521) wurde das Amt des Secretarius intimus geschaffen dieses hatte Pietro Ardighello inne; er half Kardinal Giulio de` Medici, der die Leitung der Staatsgeschäfte übernommen hatte, bei der Korrespondenz in der Landessprache, besonders mit den Apostolischen Nuntien und zwar im Namen des Papstes und nicht mehr mit dessen Unterschrift. Fast zeitgleich mit dem Amt des Secretarius domesticus kam auch die Institution des Kardinalnepoten auf. Der Kardinalnepot bezeichnet einen Blutsverwandten des Papstes, der als dessen besonderer Vertrauensmann mit der Leitung der Kirchenpolitik betraut war. Klaus Mörsdorf führt zu recht an: Man würde dem Institut der Kardinal-Nepoten indessen nicht gerecht, wollte man in ihm nichts anderes sehen als eine Begünstigung von Verwandten, die in der allgemeinen Erscheinung des Nepotismus so düstere Schatten auf die Geschichte des Papsttums geworfen hat. In der Geschichte der Kardinal-Nepoten sind Licht und Schatten kräftig gemischt. Als positives Beispiel mag die Erwähnung des heiligen Karl Borromäus dienen. Pius IV. (Giovan Angelo de Medici, 1559-1565) hatte seinen erst 21jährigen Neffen 1560 zum Kardinalnepoten und Erzbischof von Mailand berufen. Karl Borromäus wurde die rechte Hand des Papstes und zu dessen gutem Geist. Er erwies sich als unermüdlicher Förder der Kirchenreform seinem Bemühen ist es letztendlich zu verdanken, dass das Konzil von Trient fortgesetzt und erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Oberhirte von Mailand ging als einer der großen heiligen Bischofsgestalten in die Kirchengeschichte ein. Der Secretarius intimus, auch Secretarius Papae oder Secretarius maior genannt, war lange Zeit hindurch fast immer ein Prälat und nicht selten mit der Bischofswürde ausgezeichnet. Erst seit dem Pontifikat Papst Innozenz X. (Giovanni Battista Pamphilj, 1644-1655) wurde für dieses hohe Amt ein Kardinal berufen. Das Verhältnis von Geheimsekretär und Kardinalnepoten wechselte von Pontifikat zu Pontifikat, bald lag der (kirchen-)politische Einfluss beim dem einen, bald bei dem anderen. Oft kam es sogar vor, dass beide über das gleiche Personal verfügten. Papst Innozenz XII. (Antonio Pignatelli, 1691-1700) schaffte dann mit der Bulle Romanum decet Pontificem vom 22. Juni 1692 den Nepotismus, und damit auch das Amt des Kardinalnepoten, endgültig ab; alle bisherigen Vollmachten des Nepoten übernahm nun ein Kardinalstaatssekretär. Dieser war sowohl für die Kirchenpolitik als auch für die inneren und äußeren Angelegenheiten des Kirchenstaates zuständig. 1833 unterzog Papst Gregor XVI. (Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari, 1831-1846) das Staatssekretariat einer Reform; er setzte u. a. einen zweiten Staatssekretär ein per gli affari di Stato interni für die inneren Angelegenheiten des Staates , der für die Verwaltungsgegebenheiten des Kirchenstaates zuständig war. Der selige Pius IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1846-1878) schaffte 1846 das Amt eines zweiten Staatssekretärs wieder ab, beließ es jedoch bei der Einteilung des Staatssekretariates in zwei Sektionen, von denen sich die eine um die inneren, die andere um die äußeren Angelegenheiten des Heiligen Stuhles kümmerte. Der heilige Pius X. (Giuseppe Sarto, 1903-1914) gab mit der Apostolischen Konstitution Sapienti consilio vom 29. Juni 1908 dem Staatssekretariat eine neue Ordnung, die 1917 in den Codex Iuris Canonici, in das Gesetzbuch der Kirche, übernommen wurde (der Canon 262 spricht vom Officium Secretariae Status, cuius moderator est Cardinalis Secretarius Status). Mit der Kurienreform Papst Pauls VI. (Giovanni Battista Montini, 1963-1978) gewann das Staatssekretariat eine neue Stellung im Kirchenstaat, es wurde als oberste Kurienbehörde mit weitreichenden Kompetenzen und Vollmachten gleichsam zu einem vatikanischen Superministerium. Das reformierte Staatssekretariat hat die Aufgabe, dem Papst unmittelbar in der Sorge für die Gesamtkirche und in den Beziehungen zu den Kurialbehörden zu unterstützen. In seine Kompetenz fällt alles, was der Papst ihm überträgt, aber auch all das, wofür keine andere kuriale Behörde zuständig ist. Es ist das Ohr, das Herz und der Arm des Papstes (Paul Poupard). Die siebziger Jahre brachten dem Päpstlichen Staatssekretariat einen weiteren Kompetenzzuwachs. Durch das Motu Proprio Quo aptius vom 27. Februar 1973 wurde die altehrwürdige Apostolische Kanzlei aufgehoben und ihre Agenden dem Staatssekretariat übertragen; desgleichen geschah mit den Aufgaben des Sekretärs für die Schreiben an die Fürsten und des Sekretärs für die Lateinischen Schreiben. Mit dem Handschreiben Le sollecitudini crescenti vom 6. April 1984 übertrug Johannes Paul II. dem Kardinalsstaatssekretär das Mandat, den Papst in den Gewalten und in der Verantwortung für den Staat der Vatikanstadt zu repräsentieren. Fast zwanzig Jahre nach der einschneidenden Kurienreform Pauls VI. erließ Papst Johannes Paul II. (Karol Wojtyla, 1978-2005) am 28. Juni 1988 eine eigene, grundlegende Verfügung zur Römischen Kurie, die Apostolische Konstitution Pastor Bonus. Zum Päpstlichen Staatssekretariat vermerkt die Apostolische Konstitution im Artikel 39 kurz und präzise: Das Staatssekretariat hilft dem Papst bei der Ausübung seines höchsten Amtes. Der Artikel 40 fährt dann fort: Ihm steht der Kardinalstaatssekretär vor. Es umfasst zwei Sektionen, nämlich die Sektion für die allgemeinen Angelegenheiten, unter der unmittelbaren Leitung des Substituten, dem ein Assessor zur Seite steht, und die Sektion für die Beziehungen mit den Staaten, unter der Führung eines eigenen Sekretärs, dem ein Subsekretär zur Seite steht. Die Aufgabe der ersten Sektion besteht laut Pastor Bonus darin, die Angelegenheiten zu erledigen, die den täglichen Dienst des Papstes betreffen; solche Angelegenheiten zu behandeln, die außerhalb der ordentlichen Zuständigkeit der Dikasterien [Behörden] der Römischen Kurie und der anderen Einrichtungen des Apostolischen Stuhles behandelt werden müssen; die Beziehungen zu diesen Dikasterien zu fördern ohne jede Beeinträchtigung ihrer Autonomie sowie deren Tätigkeiten zu koordinieren; den Dienst der Gesandten des Heiligen Stuhls und deren Tätigkeit verantwortlich zu leiten, besonders was die Teilkirche betrifft sowie alles zu erledigen, was die Gesandten der Staaten beim Heiligen Stuhl angeht (Art. 41). Desweiteren kommt es der Sektion zu, die Apostolischen Konstitutionen, die Dekrete, die Apostolischen Schreiben, die Briefe und die übrigen Dokumente, die der Papst ihr anvertraut, abzufassen und zu verschicken; alle Vorgänge zu erledigen, die Ernennungen betreffen, welche in der Römischen Kurie und in den anderen zum Heiligen Stuhl gehörenden Einrichtungen entweder vom Papst vollzogen oder bestätigt werden müssen; das Bleisiegel und Fischerring aufzubewahren (Art. 42). Ferner ist die erste Sektion damit beauftragt, die Herausgabe der Akten und öffentlichen Dokumente des Apostolischen Stuhls in der amtlichen Veröffentlichung zu besorgen, die den Titel Acta Apostolicae Sedis trägt; die amtlichen Nachrichten, welche sich entweder auf Akte des Papstes oder auf die Tätigkeit des Heiligen Stuhls beziehen, mittels eines eigenen Amtes, das allgemein Vatikanischer Pressesaal genannt wird, öffentlich zu machen und zu verbreiten; nach Abstimmung mit der zweiten Sektion über die Zeitung, die Osservatore Romano genannt wird, sowie über Radio Vatikan und über das Vatikanische Fernsehzentrum zu wachen (Art. 43). Mit Hilfe des Zentralamtes für kirchliche Statistik hat die Sektion zudem alle Daten zu sammeln, zu koordinieren und zu veröffentlichen, die das Leben der Universalkirche auf der ganzen Welt betreffen (Art. 44). Aufgabe der zweiten Sektion ist es, all das zu erledigen, was mit den Verantwortlichen der Staaten zu behandeln ist (Art. 45). Sie hat, vor allem die diplomatischen Beziehungen zu den Staaten und zu den anderen Zusammenschlüssen öffentlichen Rechts zu fördern und gemeinsame Angelegenheiten zu behandel, damit das Wohl der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft gefördert werde, auch, wo es möglich ist, durch Konkordate und andere Verträge dieser Art, und unter Beachtung des Votums der betreffenden Bischofskonferenzen; nach Beratung mit den zuständigen Dikasterien der Römischen Kurie den Heiligen Stuhl bei den internationalen Einrichtungen und bei Konferenzen über Fragen öffentlichen Rechts zu verhandeln; das zu behandeln, was innerhalb ihres spezifischen Zuständigkeitsbereiches die päpstlichen Gesandten anbelangt (Art. 46). In besonderen Fällen erledigt diese Sektion im Auftrag des Papstes und nach Beratung mit den zuständigen Dikasterien der Römischen Kurie alles, was die Besetzung der Teilkirchen sowie die Errichtung und Veränderung von Teilkirchen und ihrer Zusammenschlüsse anbelangt ... dort, wo ein Konkordat gilt, kommt es ihr zu, alles zu erledigen, was mit den Regierungen der Staaten verhandelt werden muß (Art. 47). Il mio Ministero fu un puro effetto del caso Mein Amt als Staatssekretär war ein reiner Zufall, gesteht Consalvi in seinen Memoiren. Der 1757 in der Ewigen Stadt geborene Kardinal enstammte dem mittleren Adel und hatte seine Laufbahn als Richter im Kirchenstaat begonnen. Nach der französischen Besatzung Roms im Jahre 1798 war er für anderthalb Monate in der Engelsburg eingekerkert gewesen und dann des Landes verwiesen worden. Zuflucht fand er in Venedig, wo er 1800 Sekretär des Konklaves wurde, das zur Wahl Pius VII. führte. Während des langen Konklaves hatte sich der künftige Pontifex von der Arbeitskraft und Gewandtheit Consalvis überzeugen können. Unmittelbar nach seiner Wahl ernannte ihn der Chiaramonti-Papst zu seinem vorläufigen Staatssekretär aus der Vorläufigkeit sollten dann dreiundzwanzig Jahre werden. Um sich in das feine Spiel der großen Mächte einzuschalten und sich ihre Meinungsverschiedenheiten und auftretenden Spannungen zunutze zu machen, war, so Burkhart Schneider S.J., das Geschick eines Consalvi erforderlich ohne Übertreibung kann man feststellen, dass Tayllerand für Frankreich und Consalvi für den Kirchenstaat die beiden großen Meister in dem Diplomatenringen des Wiener Kongresses waren. Für das Papsttum und die Kirche erwies sich Ercole Consalvi als unentbehrlich in der Auseinandersetzung mit Napoleon, in der Wiedererrichtung des Kirchenstaates und in der Bewältigung der kirchlichen Neuordnung Deutschlands. Der am 2. April 1806 in Sonnino geborene und aus einfachen Verhältnissen stammende Giacomo Antonelli war nach dem Studium des weltlichen und kirchlichen Rechts 24jährig in den Diensten des Papstes eingetreten. Er erwies sich als hervorragender Jurist und Verwaltungsfachmann. Als Apostolischer Delegat (Gouverneur) in Orvieto, Viterbo und Macerata bewährte er sich in der Berwältigung der revolutionären Umtriebe, von denen der Kirchenstaat heimgesucht wurde. 1841 berief ihn Gregor XVI. in das Innenministerium; 1845 wurde er der Generalschatzmeister der Apostolischen Kammer und damit päpstlicher Finanzminister. Zwei Jahre später verlieh ihm Pius IX. den Kardinalspurpur. An Antonellis Fähigkeiten bestanden keinerlei Zweifel, nicht einmal bei seinen Gegnern Mochte er auch bei der Bevölkerung unbeliebt sein und nur wenige persönliche Freunde besitzen, so erkannte man doch allgemein die Schärfe seines Verstandes, die ihm eigene Gabe kühler Kalkulation, seine unerschütterliche Festigkeit und seine außergewöhnliche Arbeitskraft an (Walter Brandmüller). Für Antonelli galt: Die Vorsehung hat es gefügt, dass der Papst die weltliche Gewalt zum Heile der Religion und der Kirche besitze, wie er sie auch seit langen Jahrhunderten bereits in rechtmäßigem Besitze hat. Die Verteidigung der Rechte des Heiligen Vaters und nicht nur der weltlichen waren dem Kardinalstaatssekretär ein echtes Anliegen. Mit seiner Politik schuf er dem seligen Pius IX. eine nicht unbeträchtliche Handlungsfreiheit für dessen religiöses und seelsorgerliches Wirken (wie die Durchführung und der Abschluß des I. Vatikanischen Konzils). Das 20. Jahrhundert kann an Kardinalstaatssekretären so klangvolle und gewichtige Namen aufführen wie Mariano Rampolla del Tindaro (von 1887 bis 1903), Raffaele Merry del Val (von 1903 bis 1914), Pietro Gasparri (von 1922 bis 1930) und Eugenio Pacelli (von 1930 bis 1939). Das Pontifikat Pius XII. (Eugenio Pacelli, 1939-1958) verzeichnete eine Bsonderheit. Als Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione am 22. August 1944 verstarb, berief der Papst keinen Nachfolger. Erst nach neun Jahren wurden Monsignore Giovanni Battista Montini, der Leiter der Sektion für die allgemeinen Angelegenheiten, und Monsignore Domenico Tardini, der Verantwortliche der Sektion für die Beziehungen zu den Staaten, zu Prostaatssekretären ernannt. Pius XII. war sich aus verschiedensten Gründen lieber sein eigener Kardinalsstaatssekretär. Über die Frage, warum der Heilige Vater keinen Nachfolger bestimmt hatte, ist viel spekuliert worden aber wie gewöhnlich, ist auch hier die einfache, aus den Gegebenheiten hervorgehende Begründung wohl die richtige; niemand anders in Rom kannte sich in der schwierigen Weltsituation zur Zeit von Magliones Tod aus wie Pius XII., der in diese Situation als Staatssekretär und vorheriger Nuntius in Deutschland hineingewachsen war, so Bruno Wüstenberg. Als Paul VI. am 2. Mai 1969 einen Franzosen, Jean Kardinal Villot, den vormaligen Erzbischof von Lyon, in das Amt des Staatssekretärs berief, war dies für viele in Rom eine Überraschung, ein Schock. Für den Montini-Papst jedoch nur eine logische Konsequenz seiner mit Beharrlichkeit forcierten Internationalisierung der Römischen Kurie. Die Villot zukommende Machtfülle musste dieser jedoch mit dem Substituten im Päpstlichen Staatssekretariat, Erzbischof Giovanni Benelli, teilen. Das Amt des Substituten hatte seit dem Pontifikat Pauls VI. enorm an Bedeutung gewonnen und war durch den Charakter des damaligen Amtsinhabers noch mehr hervorgetreten Benelli war ein agressiver, autoritärer, arbeitsbesessener Meister des Details, der sich vollständig seinem Chef [d. h. dem Papst] und dessen Politik verschrieben hatte; er hatte keine Angst davor, der Böse zu sein, urteilte Thomas J. Reese in seinem 1996 erschienenen Buch Im Innern des Vatikan. Bei der Umsetzung der nachkonziliaren Reformen scheute der Substitut nicht davor, wie es ein Sprichtwort formuliert, über Leichen zu gehen. Als Kardinal Jean Villot im Jahre 1979 verstarb, sorgte Papst Johannes Paul II. ebenfalls für eine Überraschung. Er ernannte Monsignore Agostino Casaroli, den emsigen Außenminister des Heiligen Stuhls, zu seinem Staatssekretär. Die Verwunderung war groß. Erfreute sich doch der Architekt der vatikanischen Ostpolitik bei den osteuropäischen Oberhirten nicht gerade großer Beliebtheit. Vor allem der polnische Episkopat war auf Agostino Casaroli nicht besonders gut zu sprechen, ja er erhob massiv Einwände gegen dessen Person. Doch die unbestreitbar politische Begabung und hohe internationale Reputation Casarolis der Prälat hatte zeitweise den Vorsitz bei der KSZE geführt dürften den Papst zu seiner Entscheidung bewogen haben. Experten sahen hierin einen klugen Schachzug des Wojtyla-Papstes. Als Kardinal Casaroli 1990 in Pension ging, ernannte der Papst Angelo Sodano zum Staatssekretär. Johannes Paul soll davon beeindruckt gewesen sein, wie Sodano als Apostolischer Nuntius in Chile (1978-1988) die Angelegenheiten der Kirche unter dem Pinochet-Regime vertreten hatte er hatte dazu aufgerufen, Konfrontationen mit dem Regime zu vermeiden, und dafür gesorgt, daß ausschließlich konservative Bischöfe berufen wurden, lauet hierzu der Kommentar von Thomas J. Reese. Im zweiten Jahr seines Pontifikats ernannte Papst Benedikt XVI. den Oberhirten von Genua, Kardinal Tarcisio Bertone SDB, zu seinem Staatssekretär. Bertone hatte dem Heiligen Vater jahrelang (von 1995 bis 2002) als Sekretär der Glaubenskongregation zur Seite gestanden. In einem Interview mit Andrea Tornielli, dem Vatikanisten der Mailänder Tageszeitung Il Giornale, gab Kardinal Bertone einst an, der wichtigste Aspekt seines Amtes sei, daß der Staatssekretär ein Mann sein müsse, der treu zum Papst steht. Er habe der Treibriemen des Willens des Papstes zu sein. Ich hoffe, so der Kardinal, die geistliche Sendung der Kirche betonen zu können, die über Politik und Diplomatie hinausgeht. Monsignore Luigi Bettazzi, der emeritierte Oberhirte seines Heimatbistums Ivrea, habe ihm gesagt, es sei wichtig, mehr Kirchensekretär als Staatssekretär zu sein (Mons. Luigi Bettazzi galt auf dem II. Vatikanischen Konzil als kämpferischer Vertreter des progessistischen Flügels und rührt noch heute eifrig die Trommel für abstruse Vorschläge). Papst Johannes Paul II. hat eine Reform der Kurie durchgeführt. Nach fast zwei Jahrzehnten ist es verständlich, daß man die Organisation der Kurie überprüft und darüber nachdenkt, wie sie im Sinne der Mission der Kirche immer effizienter gestaltet werden kann, äußerte sich Bertone im weiteren Verlauf des Interviews. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuVatikan
| 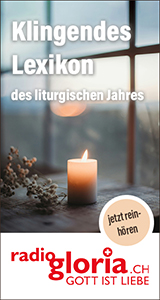      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

