 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Das Martyrium als ein Charakteristikum des christlichen Glaubens12. Oktober 2008 in Chronik, keine Lesermeinung Anmerkungen zum Gedenktag der heiligen Teresia Benedicta a Cruce Edith Stein. Von Ulrich Nersinger. Rom (www.kath.net/ Zenit) Die christliche Antike war gekennzeichnet durch das Martyrium, durch das unbedingte, radikale Einstehen für den Glauben. Vom Kirchenschriftsteller Tertullian stammt der Ausspruch: Sanguis martyrum semen Christianorum Das Blut der Märtyrer ist der Samen für (neue) Christen. Der missionarische Auftrag der Kirche wurde in allen Jahrhunderten durch das Blutzeugnis begleitet. Aber auch innerhalb einer christlichen Gesellschaft verschwand das Martyrium nicht; das Einstehen für Glaubenswahrheiten war und ist nicht ungefährlich, es zieht Konsequenzen nach sich: 1044 wurde auf Befehl König Heinrichs II. der Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, in seiner Kathedrale ermordet. Jahrhunderte später ließ Heinrich VIII. er trug den vom Papst verliehenen Ehrentitel eines Verteidigers des Glaubens Defensor Fidei Sir Thomas More und viele kirchentreue Katholiken hinrichten. Während der Französischen Revolution, die den Menschen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bringen sollte, bekundeten in Frankreich, der ältesten Tochter der Kirche, Christen ihren Glauben unter dem Fallbeil der Guillotine. In den Ländern, in denen sich die Aufklärung als Ersatzreligion präsentierte, fanden sich die Gläubigen als Feinde einer neuen Welt vor. Und gerade unsere Zeitepoche wurde wieder zu einem Jahrhundert der Märtyrer: Nach dem Zusammenbruch des zaristischen Reiches rissen die Kommunisten in Russland die Macht an sich und initiierten eine blutige Verfolgung des Christentums eine Verfolgung, die auf weitere Länder und Kontinente übergriff und bis in unsere Zeit dauert (China, Vietnam, Nordkorea). In Mexiko wurde die Kirche mit der unversöhnlichen Gegnerschaft antikirchlicher und freimaurerischer Kräfte konfrontiert, im spanischen Bürgerkrieg entfesselten die Republikaner einen hasserfüllten Kampf gegen den Katholizismus und auch das Dritte Reich konnte keinen anderen Glauben dulden als den an sich. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) sah im Martyrium die Hochform und Grundgestalt der christlichen Heiligkeit. Die Väter waren sich der heilsgeschichtlichen Dimension des christlichen Blutzeugnisses bewusst, das Martyrium empfanden sie al ein außerordentliches Geschenk (eximium donum) an die Gemeinschaft der Glaubenden. Als Johannes Paul II. 1978 zum Nachfolger des heiligen Petrus gewählt wurde, trat ein Mann das Oberste Hirtenamt an, der in seinem Leben mit zwei glaubensfeindlichen Ideologien dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus in Berührung gekommen war. Seine persönlichen Erfahrungen sensibilisierten ihn für jenes radikale Glaubenszeugnis, das so vielen Christen in diesem Jahrhundert abgefordert wurde. Im Apostolischen Schreiben Tertio Millennio Adveniente, das der Vorbereitung auf das Jubeljahr 2000 diente, schrieb daher der Papst: In unserem Jahrhundert sind die Märtyrer zurückgekehrt, gleichsam unbekannte Soldaten der großen Sache Gottes. Soweit als möglich, dürfen ihre Zeugnisse in der Kirche nicht verloren gehen. Von den Ortskirchen muß alles unternommen werden, um durch das Anlegen der notwendigen Dokumentation nicht die Erinnerung an die zu verlieren, die das Martyrium erlitten habe. Die kirchenrechtliche Dimension des Martyriums Damit aber das Martyrium als ein Charakteristikum der Kirche präsent wird, in das Leben der Glaubensgemeinschaft eingebunden werden kann, bedarf es einer juridischen Prozedur. Dies war nicht immer so. In der Frühzeit der Kirche stand das Zeugnis der Märtyrer allen vor Augen. Die Mitglieder der christlichen Gemeinden kannten sich alle sahen, was in und mit der Kirche geschah. Das Marty¬rium, das mit dem eigenen Leib gegebene Beispiel für das Evangelium Jesu Christi, war jedem durch den eigenen Augenschein bekannt und genügte voll¬ständig als Beweis der Heiligkeit. Eines der frühesten Zeugnisse für die Heiligenverehrung ist der Bericht vom Martyrium des Polykarp (um 155); schon in diesem Dokument finden sich alle Grundzüge der christlichen Heiligenverehrung: Wir kamen in den Besitz der Gebeine des Märtyrers, die wertvoller sind als Edelsteine und kostbarer als Gold. Wir bestatteten dieselben an geeigneter Stelle, wo wir uns wo möglich in Jubel und Freude versammeln, um mit der Gnade des Herrn den Tag seines Martyriums und seiner Geburt zu feiern ... Christus beten wir an, weil er der Sohn Gottes ist. Die Blutzeugen aber lieben wir als Jünger und Nachahmer des Herrn und wegen ihrer unvergleichlichen Hingabe an ihren König und Meister. Möchten doch auch wir ihre Gefährten und Mitschüler werden! Die einzelnen Heiligen, die Märtyrer, genossen zuerst nur eine lokale Verehrung. Große Gemeinden führten Listen mit den Todestagen der Blutzeugen später wurden in diesen auch die Namen auswärtiger Heiliger aufgenommen. Für die Verbreitung eines Kultes war die Übertragung (translatio) oder die Er¬hebung (elevatio) der Reliquien wichtig. Die weitere Entwicklung führte dazu, dass die Reliquien entweder in einem Altar eingemauert oder in einem Schrein an eine gut sichtbare Stellung zur Verehrung erhoben wurden. Die translatio oder elevatio der Reliquien war bis weit ins Mittelalter hinein der eigentliche kultbegründende Akt. Als zuständig und verantwortlich dafür zeichnete der jeweilige Ortsbischof. Oft geschahen Heiligsprechungen auch im Rahmen einer Synode oder eines Konzils. Als Papst Alexander III. (Rolando Bandinelli, 1159-1181) im Jahre 1170 Kenntnis von einem besonders gravierenden Fall des Missbrauches erhielt, leitete er mit dem Schreiben Audivimus (Wir haben gehört) eine neue Epoche ein, die zu einer Kontrolle durch das oberste Hirtenamt führte. Mit der Aufnahme dieses Briefes in die Dekretalensammlung Gregors IX. (Ugolino dei Conti di Segni, 1227-1241) wurde nunmehr festgestellt, dass sich der Heilige Stuhl die endgültige Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung der Heiligkeit eines verstorbenen Katholiken vorbehält. Trotz dieser grundsätzlichen päpstlichen Reservation fuhren viele Bischöfe noch Jahrhunderte lang fort, Heiligsprechungen oder Kultbestätigungen vorzunehmen. Auch als Papst Sixtus V. (Felice Peretti, 1585-1590) der Römischen Kurie mit der Apostolischen Konstitution Immensa aeterni Dei vom 22. Januar 1588 eine Ordnung gab und die Selig- und Heiligsprechungsprozesse der neugeschaffen Hl. Kongregation für die Riten (Sacra Congregatio Rituum) überantwortete, war diesen Vorgängen noch kein definitiver Einhalt geboten worden. Erst Papst Urban VIII. (Maffeo Barberini, 1623-1644) griff in die desolate Lage dieser Rechtsmaterie und unsicherheit ein; ihm war es ein Anliegen, Missbräuche abzustellen oder zu verhindern und die Prozedur in den Heiligsprechungsverfahren definitiv zu regeln. Nach einer Reihe kleiner Anordnungen in den Jahren 1625 - 1633 erließ er am 5. Juli 1634 das Päpstliche Breve Caelestis Hierusalem. Alles, was die Verehrung eines künftigen Seligen oder Heiligen betraf, sollte allein dem Heiligen Stuhl vorbehalten sein. Jede öffentliche, das heisst nicht private Verehrung ohne dessen Erlaubnis war nun verboten. Die Bestimmungen Urbans VIII. hatten aber nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit Bedeutung. Alle die vor dem Pontifikat Alexanders III. verehrt wurden, durften auch weiterhin öffentlich verehrt werden. Auch der Kult für jene, die in der Zeit von Alexander III. bis 1534, 100 Jahre vor der Entscheidung Urbans VIII. öffentliche Verehrung zukam, blieb weiterhin gestattet. Für sie musste jedoch beim Heiligen Stuhl um eine Genehmigung ihrer Verehrung nachgesucht werden, so dass es von nun ab zwei Wege bei der Führung von Selig- und Heiligsprechungsprozessen gab: den ordentlichen Prozess (per viam ordinariam) und den außerordentlichen (per viam cultus). Für beide Prozesswege stellte der Papst eingehende Bestimmungen auf. Eine bahnbrechende historische, theologische und kirchenrechtliche Durchdringung der Materie der Selig- und Heiligsprechungen sollte jedoch erst das Werk des Kardinals Prospero Lambertini, des späteren Papst Benedikt XIV. (1740-1758), bringen in seiner theologischen Lehre besonders zur heroischen Tugend, dem Martyrium und den Wundern besitzt sein Werk auch noch heute große Aktualität (Marcus Sieger). Laut Prospero Lambertini ist für die Selig- und Heiligsprechung eines Nichtmärtyrers der Nachweis der heroisch ausgeübten Tugenden zu erbringen. Heroische Übung der Tugenden heißt zunächst die Verwirklichung jener des Glaubens (fides), der Hoffnung (spes) und der Liebe (caritas). Auf diese drei theologischen Tugenden aufbauend wird die Umsetzung der vier Kardinaltugenden Klugheit (prudentia), Gerechtigkeit (iustitia), Tapferkeit (fortitudo), Mäßigung (temperantia) gefordert. Die Ausübung der Tugenden muss in einem außergewöhnlichen, überragenden Grad geschehen, in dem die gewöhnliche Weise des Handels auch von guten Christen übertroffen wird. Gemäß Benedikt XIV. muss sie unabdinglich in Freiheit und Freiwilligkeit ausgeübt worden sein und nicht aus einer wie auch im¬mer gearteten Verpflichtung heraus. Die klassische Theologie des Martyriums, wie sie vom heiligen Thomas von Aquin in seiner Summa theologiae (II. II, 124) definiert worden war, fasste Benedikt XIV. in einer kirchenrechtlichen Kurzformel zusammen: Martyrium esse voluntariam mortis perpessionem sive tolerantiam propter fidem Christi vel alium virtutis actum in Deum relatum Das Martyrium ist der gewaltsame Tod, der im Namen des christlichen Glaubens oder eines anderen mit dem Glauben verbundenen Wertes angenommen wird. Der Papst nennt vier Grundelemente, die gegeben sein müssen, damit die Kirche ein Martyrium anerkennen kann. Diese Grundelemente betreffen - den Verfolger (persecutor seu tyrannus): Der Verfolger muss eine vom Märtyrer verschiedene Person sein. Er kann eine physische, aber auch eine moralische Person (eine Staatsregierung, eine Partei, eine re¬ligiöse Organisation u.ä.) sein. Der Verfolger muss die Ursache des Martyriums sein. Er kann direkt oder indirekt handeln. Er kann den Tod selber ausführen oder nur befehlen. Er kann ein Ungläubiger, ein Häretiker oder sogar ein Katholik sein (so erlitt der heilige Thomas Becket das Martyrium durch einen christlichen Monarchen; ein Katholik, Alessandro Serenelli, tötete 1902 die sich ihm verweigernde 11jährige Maria Goretti). - die Strafe/den Tod (poena/mors) Die Strafe, die verhängt wird, muss der Tod sein man sprach früher ganz drastisch von der effusio sanguinis, vom Vergießen des Blutes. Ohne dass der Tod erlitten wird, kann man nicht von einem Martyrium sprechen. Es ist unerheblich, ob der Tod sofort eintritt, oder ob man nach dem Empfang tödlicher Wunden noch eine kürze oder längere Zeit überlebt. Der Tod kann direkt oder indirekt herbeigeführt werden. Indirekt beispielsweise, indem der Verfolger den Tod durch Folter bewirkt. Wenn der Tod indirekt herbeigeführt wird, müssen die vom Verfolger geschaffenen Umstände, natürliche sein, die den Körper betreffen (seelische Schmerzen genügen nicht). Sie müssen bis zum Tod dauern und ihn auch herbeiführen. - die Ursache der Strafe (causa martyrii) Der heilige Augustinus sagt, dass den Märtyrer nicht die Strafe ausmache, sondern deren Ursache (Martyres non facit poena, sed causa). Diese Ursache muss begründet liegen im Hass auf den Glauben (in odium fidei). Der Hass auf den Glauben kann erschlossen werden aus dem Todesurteil (und eventuellen Gerichtsakten) des Verfolgers, aus dem Gespräch zwischen dem Verfolger und dem Diener Gottes oder aus Versprechungen an den Diener Gottes, für den Fall, dass er den Glauben verleugnet. Für den Nachweis des odium fidei, ist es nicht notwendig, dass der Verfolger direkt oder formell aus Hass gegen Gott, die Kirche oder die Glaubenslehre agiert; es genügt, wenn er aus ideologischen oder anderen Gründen einen Katholiken zwingen will, eine Tat zu begehen, die dieser nicht tun kann, ohne zu sündigen. - die Anforderungen an den Märtyrer (habitus martyri) So, wie der Verfolger durch den Hass auf den Glauben angetrieben wird, so ist der Märtyrer durch die Liebe zum Glauben (amor in fidem) motiviert. Der Glaube, für den der Märtyrer stirbt, kann aber nicht der an irgendeiner Wahrheit, sondern muss der an eine göttliche Wahrheit sein. Glaube ist aber nicht nur Zustimmung, sondern auch als Aktion und Handlungsweise zu verstehen, als die praktische Umsetzung der Glaubenswahrheiten. Unverzichtbar für die Anerkennung des Martyriums ist das freiwillige Aufsichnehmen des Todes (dies muss sich nicht unbedingt in einem eigenen Akt äußern, es genügt eine implizite Zustimmung). Das Martyrium ist eine Gabe Gottes und eine eigene Berufung man kann es nicht an sich reißen. So verbietet sich auch die Provokation des Verfolgers. Christen, die in Kreuzzügen und Glaubenskriege ihr Leben ließen, waren daher für die Kirche nie automatisch Kandidaten für Selig- und Heiligsprechungen. Hier denkt und urteilt die Kirche anders als das Judentum (Stichwort: Masada) und der Islam (Stichwort: Heiliger Krieg). Christus nahm den Tod in Gehorsam auf sich: ausharren und aushalten sind daher das Postulat. Eine solche Haltung erfordert eine Stärke, die viel größer und erhabener ist als das Angreifen. Nach Thomas von Aquin ist dies der höch¬ste Akt der Tugend der Tapferkeit - sustinere est difficilius quam aggredi (Summa theologiae, II-II q. 123 art. 6 ad 1). Die Flucht vor einer Verfolgung wurde von der Kirche stets für legitim gehalten. Sie muss jedoch gerechtfertigt sein und darf nicht den Eindruck von Schwäche vermitteln. So darf sie z.B. keine Verletzung von Pflichten sein, die ein Seelsorger gegenüber der ihm anvertrauten Gemeinde zu erfüllen hätte. Steht das Martyrium einem Christen von Angesicht zu Angesicht gegenüber und stellt es die alles entscheidende Frage des Glaubens, so muss es in der Kraft eben dieses Glaubens angenommen werden. Neue Dimensionen des christlichen Martyriums Das II. Vatikanische Konzil sah im Martyrium die Hochform und Grundgestalt der christlichen Heiligkeit. Die Väter der Kirchenversammlung waren sich der heilsgeschichtlichen Bedeutung des christlichen Blutzeugnisses bewusst; das Martyrium empfanden sie als ein außerordentliches Geschenk eximinum donum an die Gemeinschaft der Glaubenden. Das 20. Jahrhundert gab in erschreckender Weise davon Zeugnis, wie die Methoden der Folterung und Vernichtung des Menschen Ausmaße annahmen, die traditionelle Vorstellungen über ein Martyrium überdenken ließen. Moderne psychologische Erkenntnisse und in Hightech-Laboratorien entwickelte Drogen haben die Kunst der Folter perfektioniert (so lässt sich heute sogar ein rein seelischer Tod herbeiführen, ohne dass der menschliche Körper zerstört wird). Aber auch die Rechtslage des Martyriums hat sich gewandelt, denn die modernen Christenverfolger der Neuzeit geben den Christen oft gar keine Gelegenheit mehr, ihren Glauben im alten Stil der ersten christlichen Jahrhunderte zu bekennen und den Tod durch Gerichtsbeschluss anzunehmen. Die Kirche sah sich gezwungen, auch auf diese geänderte Situation einzugehen; der Dominikanerpater Ambrosius Eßer, Offizial der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren, bemerkt daher zu recht, dass sie die Argumente Krimineller nicht akzeptieren darf. Wir können nicht beim Prozess zurückstecken und Lügner bevorzugen, bloß weil diese sagen, dass sie nichts gegen die Religion haben. Maximilian Kolbe Ebenso zeigen sich neue Akzente und Wege in der theologischen Bewertung des Martyriums. Einen Meilenstein in dieser Entwicklung setzte die Heiligsprechung des Minoritenpaters Maximilian Kolbe. Der Ordensmann hatte sich im Konzentrationslager von Auschwitz angeboten, die Stelle eines Familienvaters einzunehmen, der zum Hungertode verurteilt worden war. Nach sechzehn qualvollen Tagen beendete eine Giftspritze das Leben des katholischen Geistlichen. Der Prozess bei der römischen Kongregation wurde als Verfahren für die Seligsprechung eines Bekenners geführt. Die Juristen der Kongregation sahen mit Blick auf die klassische Lehre vom Martyrium zu viele formale Schwierigkeiten, um den Tod Pater Kolbes als Blutzeugnis anzuerkennen. So merkte ein Gutachter an, dass Kolbe ursprünglich nicht aus Glaubensgründen verhaftet worden sei, auch habe er seinen Tod angeboten. Am 17. Oktober 1971 erklärte die katholische Kirche Maximilian Kolbe zum Seligen. In der Heiligsprechungsformel wurde der Geistliche als confessor (Bekenner) bezeichnet. Bei der Audienz, die Paul VI. den polnischen Pilgern am Tag nach der Beatifikation gewährte, sprach der Papst von einem Bekenner, an dem sich das Martyrium der Liebe (martirio della carità) vollzogen habe. Ein Jahrzehnt später erklärte Papst Johannes Paul II., dass er kraft seiner Apostolischen Vollmacht beschlossen habe, dass Maximilian Kolbe, der von seiner Seligsprechung an als Bekenner verehrt wurde, nunmehr als Märtyrer verehrt werde. (LOsservatore Romano, 11 Ottobre 1982, 4). Bei der Kanonisation Kolbes hatte sich also eine erweiterte, aus neuen Blickwinkeln kommende Sicht des Martyriums durchgesetzt. Der Tod des Ordensmannes wurde als ein Akt vollkommener Liebe betrachtet, als martyrium caritatis. Sr. Teresia Benedicta a Cruce Edith Stein Die Verfahren der Selig- und Heiligsprechung der Edith Stein wichen vom üblichen Prozedere in causis Sanctorum ab. Besonders das Martyrium der Ordensfrau nahm einen bedeutenden und unter neuen Aspekten gewichteten Stellenwert ein. Der Erzbischof von Köln war in der Mitte der Fünfziger Jahre von verschiedener Seite auf das Leben und Sterben der Karmeliternonne Teresia Benedicta a Cruce, Edith Stein, angegangen worden. Ihm lag auch eine kleine Schrift vor, die 1954 Mutter Teresia Renata de Spiritu Sancto, die Novizenmeisterin der ermordeten Ordensschwester, verfasst hatte. Der Kölner Oberhirte setzte sich dann mit der Ordensleitung der Karmeliter ins Einvernehmen. Im Juni 1958 beauftragte der Generaldefinitor des Ordens Mutter Teresia Renata de Spiritu Sancto mit der Abfassung der Articuli pro construendo Processu Ordinario Informativo. Als die ehemalige Novizenmeisterin Edith Steins am 23. Januar 1961 starb, waren die Artikel 1 bis 86 geschrieben. Im Auftrag des Vizepostulators wurde die Arbeit Anfang des Jahres 1962 vollendet. Nun war die Möglichkeit gegeben, den Bischöflichen Informativprozess einzuleiten. Es wurden Zeugenvernehmungen in aller Welt durchgeführt. 1972 sah sich Kardinal Josef Höffner von Köln in der Lage, die Unterlagen des Informativprozesses nach Rom zu übersenden. Die articuli vermitteln einen ersten, faszinierenden Eindruck von den in heroischem Maße gelebten Tugenden der Sr. Teresia Benedicta a Cruce. Am 19. September 1972 erteilte die Glaubenskongregation ihr nihil obstat für die Führung des römischen Verfahrens. Eine prozessuale Ausrichtung auf das Martyrium erschien den Mitarbeitern der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren aus formaljuristischen Gründen als beinahe unmöglich, das Verfahren würde daher de heroicitate virtutum, mit Ausrichtung auf den heroischen Tugendgrad, geführt werden. Aus dem transumptum (Gesamtheit der Akten) der bischöflichen Untersuchungen war für den Relator (Sachbearbeiter) der Causa ersichtlich, dass die Erstellung der positio super virtutibus mit keinerlei nennenswerten Problemen verbunden sein würde. 1980 fand der Vizepostulator des Verfahrens im Amsterdamer Rijksinstitut voor Oorlogs Dokumentatie (Reichinstitut für Kriegsdokumentation) neues Material über den gewaltsamen Tod Edith Steins und erstellte aus den Unterlagen ein umfangreiches Dossier. Diese Unterlagen und die Heiligsprechung Maximilian Kolbes als Märtyrer ließen die Hoffnung aufkommen, dass nun auch Edith Stein dieser Weg offen stehe. Am 3. März 1983 richteten die Kardinäle Josef Höffner (Deutschland) und Jozef Glemp (Polen) im Namen der Bischofskonferenzen ihrer beiden Länder das Gesuch an den Heiligen Stuhl, das Seligsprechungsverfahren der Schwester Teresia Benedicta a Cruce als Märtyrerprozess zu führen. Ihr Tod müsse als Racheakt der nationalsozialistischen Machthaber für das Auftreten der katholischen Bischöfe der Niederlande betrachtet werden, von daher sei es gerechtfertigt, in Edith Stein eine Märtyrin der Kirche zu sehen. Die Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren entschied nach eingehender Beratung, das Verfahren nun super virtutibus et martyrio (über die Tugenden und das Martyrium) zu führen. Die pragmatischen römischen Juristen hatten mit diesem Beschluss ein Novum in der Geschichte der Selig- und Heiligsprechungen erwirkt. Eventuelle Schwierigkeiten in der Beweisführung des Martyriums ließen sich nun durch den Nachweis der heroischen Tugenden ausgleichen. Die vier Elemente, die für die römischen Juristen unabdingbare Voraussetzung für die Anerkennung eines Martyriums sind, wurden auch in der Causa Edith Stein gefordert und behandelt jedoch unter Beachtung der Modifikationen, die sich durch die Begegnung mit einem Tyrannen der Moderne ergaben. So erkannte die Kongregation als den Verfolger das nationalsozialistische Regime. Der Nationalsozialismus verstand sich voll und ganz als Religion. Der Führer der Bewegung übernahm folglich die Rolle eines Messias; er handelte im Auftrag der Vorsehung. Schon in einem Geheimbericht des Preußischen Innenministeriums vom 28. August 1930 (Aktenzeichen II. 1420 a/50) hieß es: Der Nationalsozialismus ist nicht nur eine soziale oder politische Bewegung. Er will mehr sein und ist auch mehr. Er ist eine Weltanschauung. Die Nationalsozialisten verlangen eine besondere Nationalreligion, die aber mit dem positiven Christentum nichts als den Namen gemein hat. Vom Christentum zum Deutschtum heißt die Losung. Der deutsche Gedanke wird förmlich zum Gott erhoben. Die volle Ausreifung und Verwirklichung im Falle eines Sieges dieser Weltanschauung ist nur eine Frage der Zeit. Alfred Rosenbergs Tischgespräche mit dem Führer und die Tagebücher des Reichspropagandaministers Dr. Josef Goebbels bestätigten in erschreckender Weise diese Erkenntnis. Die direkte Ursache der Strafe lag in der Reaktion auf den Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe von 1942. Als die Deportation der niederländischen Juden anstand, protestierten die katholischen Oberhirten von der Kanzel herab gegen dieses Verbrechen. Die braunen Machthaber reagierten umgehend. Die Order des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD lautete: Den Haag, den 20.7.1942. Betr.: Evakuierung der christlich getauften Juden. Der Reichskommissar hat folgende Anordnung getroffen: ... Da sich die katholischen Bischöfe ohne beteiligt zu sein in Angelegenheiten gemischt haben, werden nunmehr die sämtlichen katholischen Juden noch in dieser Woche abgeschoben. Interventionen sollen nicht berücksichtigt werden. Gezeichnet: Dr. Harster. 1967 wurde Dr. Harster in München vor Gericht gestellt. Als Nebenkläger der Familie Stein fragte Dr. Robert M. W. Kempner (einer der US-Ankläger bei den Nürnberger Prozessen) den ehemaligen deutschen Polizeichef: Was war der eigentliche Grund für diese Todesbefehle gegen die katholischen Juden? Dr. Harster antwortete ohne Umschweife: Das war die Rache, das war die Vergeltung für das Verhalten der katholischen Bischöfe. Für den Relator der Causa stand fest: Als die holländischen Bischöfe gegen die Judendeportation protestierten, brach sich der Hass der Nazis auf die Kirche spontan Bahn, und von daher ist es ganz eindeutig, dass der Tod Edith Steins die Folge einer aus Hass auf den Glauben begangenen Tat war. Die Strafe selber war der Tod in der Gaskammer von Auschwitz. Über die genauen Umstände ihres Todes ist nur wenig bekannt. Als der Zug mit den deportierten katholischen Juden am 9. August in Auschwitz eintraf, dürfte Edith Stein wie die meisten ihrer Schicksalsgefährten unverzüglich in die Gaskammer gebracht worden sein. Die Schergen des NS-Regimes nahmen sich nicht einmal mehr die Zeit, ihren Namen in das Aufnahmeregister des Konzentrationslagers einzutragen. Der Niederländische Staatsanzeiger, Liste Nr. 34, vom Donnerstag, dem 16. Februar 1950, brachte folgende Notiz: Nr. 44 074, Edith Theresia Hedwig Stein, geboren 12. Oktober 1891 zu Breslau, von Echt, gestorben 9. August 1942. Wenn den kirchlichen Gerichten auch die Aussagen von Zeugen vorlagen, die sie an jenem Tag in die Gaskammer eintreten sahen, so hatte man doch niemanden, der im Augenblick ihres Todes anwesend war. Doch lässt sich ihre Disposition aus dem Weg erschließen, den sie als bekennende Katholikin beschritt, bis er am 9. August sein irdisches Ende fand. Die Anforderungen an den Märtyrer wurden durch das vielfach bezeugte Verhalten der Edith Stein erkennbar. Briefe von der Hand Edith Steins, ihre Äußerungen in ihren letzten Tagen und unzählige Menschen auf dem Weg in das Vernichtungslager geben Zeugnis von der zum Martyrium bereiten Nonne. Edith Stein war vollkommen ruhig und beherrscht. Man spürte keinen Hauch von Angst an ihr vor der unsicheren Zukunft. Am 6. August bat Edith Stein ihre Oberin noch brieflich um den nächsten Brevierband und fügte hinzu: konnte bisher herrlich beten. Im Sammellager Westerbork berichteten Zeugen, wie ruhig und gesammelt diese Schwester war, sie sei tröstend, helfend, beruhigend wie ein Engel unter den verzweifelten Frauen umhergegangen. Der Bahnhofsvorsteher Valentin Fouquet sah Edith Stein am 7. August, als der Zug nach Auschwitz kurz im pfälzischen Schifferstadt hielt: Die Dame machte einen ruhigen, freundlichen Eindruck. Man darf wohl sicher sein, dass sie den Tod zwei Tage später im Angesicht des Kreuzes entgegentrat und in der Kraft des Glaubens annahm. Am 28. Oktober 1986 kamen die theologischen Konsultoren zu einem positiven Votum der Causa, am 13. Januar des folgenden Jahres der Plenarkongress der Kongregation. Schon zwölf Tage später, am 25. Januar 1987, ordnete der Papst die Veröffentlichung des Dekretes über den heroischen Tugendgrad und das Martyrium an. Am 1. Mai wurde Edith Stein in Köln, im Müngersdorfer Stadion, selig gesprochen; am 11. Oktober 1998 sprach der Papst Johannes Paul II. Edith Stein in der Ewigen Stadt heilig. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuHeilige
| 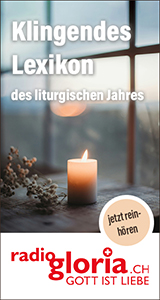      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
