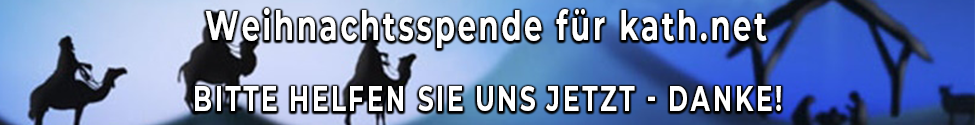 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Das Kolosseum21. März 2008 in Weltkirche, keine Lesermeinung Eine Gedenkstätte des christlichen Martyriums in Rom - Von Ulrich Nersinger. Rom (www.kath.net/Zenit) Marcus Valerius Martialis (40-104. n. Chr.) vergleicht in seiner Schrift De spectaculis (Über die Schauspiele) das Flavische Amphitheater mit den Weltwundern der Antike. Mit großem Pathos ruft der römische Schriftsteller aus: Schweige das ägyptische Memphis vom Wunder der Pyramiden, brüste assyrische Müh nicht mit Babylon sich, weichliche Ionier, rühmt euch nicht mit dem Artemistempel und der Hörneraltar lasse sein Delos nur ruhn! Karer, das Mausoleum, das ragt in die luftige Leere, hebts nicht in maßlosem Lob bis zu den Sternen empor! Jegliche Leistung verschwindet vor Caesars Amphitheater. Ein Werk feiert allein künftig statt aller der Ruhm. Jenes gewaltige Monument, das beim Domus Aurea, dem Goldenen Haus Neros, seinen Standort hat, fordert auch heute noch seinem Betrachter Staunen und Respekt ab. Nach Neros Tod und dem Vierkaiserjahr (68-69 n. Chr.) führte Vespasian viele Privatgüter des letzten Imperators aus dem julisch-claudischen Geschlecht wieder in öffentlichen Besitz über. Der große künstliche See bei Neros Goldenem Haus wurde trockengelegt im Jahre 72 begann man an dieser Stelle mit den Arbeiten für das Amphitheater. Im Mai des Jahres 80 fand unter Kaiser Titus die Eröffnung des Amphitheatrum Flavium mit hundert Tage dauernden Festivitäten statt. Endgültig fertig gestellt wurde es jedoch erst unter Kaiser Domitian (81-96). Flavisches Amphitheater hieß die Kampfstätte nach dem Namen des Kaisergeschlechtes der Flavier. Heute gebrauchen wir diese Bezeichnung kaum mehr, für uns ist es einfach das Kolosseum. Woher der Name Kolosseum kommt, darüber sind sich Archäologen und Historiker uneins. Vermutlich leitet er sich von der fünfunddreißig Meter hohen bronzenen Kolossalstatue des Nero ab, die einst in der Nähe des Amphitheaters stand. Die erste historische gesicherte Erwähnung dieser Bezeichnung findet sich im 8. Jahrhundert, in einer Schrift des Benediktinermönches Beda Venerabilis: Quamdiu stabit Colysaeus / stabit et Roma / quando cadet Colysaeus / cadet et Roma / quando cadet Roma / cadet et Mundus Solange das Kolosseum steht, besteht auch Rom. Wenn das Kolosseum fällt, fällt auch Rom. Wenn Rom fällt, fällt auch die Welt. Für den Bau des Amphitheaters wurden Holz, römischer Beton opus caementum , Ziegel, Marmor und Travertin verwendet. Schätzungen gehen davon aus, dass man 300 Tonnen Travertinblöcke (100.000 Kubikmeter), 300 Tonnen Eisen zum Klammern der Blöcke und 414.000 Tonnen Beton benötigte. Der äußere Mauerring war mehr als fünfzig Meter hoch; der größte Durchmesser der Ellipse maß 188 Meter, der kleinste 156. Die Zuschauerränge boten bis zu 70.000 Menschen Platz (50.000 Sitzgelegenheiten und 20.000 Stehplätze). Eine Besonderheit dieses gewaltigen Theaters war die Möglichkeit, die Zuschauer in der Gluthitze des Sommers durch ein eigens aufgezogenes Sonnensegel zu schützen. Zu diesem Zweck befanden sich auf dem obersten Rang zweihundertvierzig Masten. Die Bereitstellung des Tuchstoffes war übrigens eine frühe, antike Form der Werbung. Reiche römische Bürger traten publikumswirksam als Sponsoren auf und ließen ihre Namen in schon damals üblichen Programmheften vermerken. Die nicht ungefährliche Aufgabe, die Segelbahnen aufzuziehen, kam erfahrenen Matrosen der kaiserlichen Kriegsflotte zu. Im Flavischen Amphitheater wurden Gladiatorenkämpfe, die ludi gladiatorii, und Tierhatzen, die venationes, abgehalten. Die Gladiatorenkämpfe waren ursprünglich Bestandteil der großen öffentlichen Totenfeiern zu Ehren hochrangiger römischer Bürger gewesen. Im Übergang von der republikanischen zur kaiserlichen Zeit wurden die religiösen Motive dieser ludi zu Gunsten politischer Erwägungen zurückgedrängt. Bewerber um ein öffentliches Amt wie auch später die Cäsaren benutzten sie, um sich beim Volke beliebt zu machen. Die meisten Gladiatoren waren Sklaven oder Kriegsgefangene, die in eigenen Schulen für diesen Sport ausgebildet wurden. Die Besitzer solcher Ausbildungsstätten konnten es zu ungeheurem Reichtum bringen. Nur wenige Schritte vom Amphitheater entfernt, zwischen der heutigen Via Labicana und der Via di San Giovanni in Laterano, befand sich eine bedeutende Gladiatorenschule. Dieser Ludus magnus war sogar durch einen unterirdischen Gang mit dem Kolosseum verbunden. Die römischen Kaiser erweiterten später den Kreis der Gladiatoren. Domitian führte eine besondere Perversität ein: Kleinwüchsige als Zwerggladiatoren. Auch das Auftreten von Gladiatorinnen im Kolosseum gilt als gesichert schon Nero hatte in einem hölzernen Vorgängerbau Frauen, ja sogar Gemahlinnen von Senatoren kämpfen lassen. Und von Cassius Dio (Hist. Rom. LXIII, 1-2) wissen wir, dass im Jahre 66 n. Chr. in Puteoli eine Reihe von schwarzhäutigen Afrikanerinnen dieses blutige Handwerk versah; deren Ruf drang nach Rom und schon bald waren sie auch in der Urbs präsent. Die zweite große Attraktion im Amphitheater waren die Tierhatzen. Schon bei den hunderttägigen Feiern aus Anlass der Einweihung des Kolosseums spielten sie eine bedeutende Rolle. Laut dem römischen Historiker Sueton sollen an einem einzigen Tag mehr als fünftausend Tiere umgekommen sein. Im Jahre 102 ließ Trajan anlässlich seines drakischen Triumphs 11.000 Tiere töten. Zur Tausendjahrfeier Roms (247 n. Chr.) unter Kaiser Philippus starben an einem Tag 32 Elephanten, 10 Elche, 10 Tiger, 60 Löwen, 30 Leoparden, 10 Hyänen, 6 Nilpferde, 1 Nashorn, 10 Zebras, 10 Giraffen, 30 Esel und 40 Wildpferde. Noch im Jahre 281 feierte Kaiser Probus einen Triumph mit dem Abschlachten von 200 Löwen, 200 Leoparden und 300 Bären. Manche Kaiser beteiligten sich in eigener Person an den venationes. Während es Domitian vorzog, von seiner Loge aus mit Pfeil und Bogen die Tiere zu erlegen, stand Kaiser Commodus (191-192) auf einem Podest in der Mitte des Amphitheaters und betrieb von dort aus sein blutiges Spiel, besonders an dem Abschlachten von Pfauen soll er großes Vergnügen empfunden haben. Herodian berichtet, Commodus habe verkleidet als Herkules die Tiere mit einer gewaltigen Keule getötet. Die Ausrottung vieler Tierarten in den Provinzen des Römischen Imperiums geht unzweifelhaft auf den hohen Bedarf des Flavischen und der mehr als zweihundert weiteren Amphitheater des Reiches zurück. Das Kolosseum konnte auch für die vom Volk mit unglaublicher Begeisterung aufgenommenen naumachiae (Seeschlachten) unter Wasser gesetzt werden. Wenn auch hierfür alle technischen Voraussetzungen im Amphitheater vorhanden waren, so blieb doch der Aufwand für den entsprechenden Umbau der Arena immens. Schon Domitian sah daher von solchen Aufführungen im Flavischen Amphitheater ab, er ließ so berichtet es Sueton in seinen Kaiserbiographien in der Nähe des Tiber ein Bassin ausheben und Sitzreihen rundherum anlegen. Hier konnten dann Seeschlachten stattfinden, an denen beinahe reguläre Flotten teilnahmen. Von christlicher Seite haben die Spiele im Kolosseum und den anderen Amphitheatern eine konsequente Verurteilung erfahren, sei es durch Minucius Felix, Klemens von Alexandrien, Tertullian, Theophilanz, Laktanz und vielen anderen. Schon vor den Kirchenvätern und christlichen Schriftstellern hatten heidnische Autoren gegen mancherlei Spiele Stellung bezogen; vor allem Plutarch prangerte viele Formen der Kämpfe als blutiges und bestialisches Schauspiel an. Aber auch Marcus Tullius Cicero und Juvenal erhoben mahnend ihre Stimme. Juvenal hatte die Einstellung seiner römischen Mitbürger mit den Worten beklagt: duas tantum res anxius optat, panem et circenses zwei Sachen wünscht es (das Volk) sich beängstigend so sehr, Brot und Spiele. Mit der Christianisierung des römischen Imperiums kündigte sich auch langsam ein Ende der Gladiatorenkämpfe und Tierhatzen an. Kaiser Konstantin verbot 326 die damnatio ad bestias (die Ausführung eines Todesurteils durch Tiere in der Arena). Und Theodosius der Große untersagte erstmals 380 die ludi gladiatorii. Dass die entsprechenden Dekrete nicht eingehalten wurden, zeigt eine Verordnung Kaiser Theodoros aus dem Jahre 399, in der er vehement die Schließung der Gladiatorenschulen befahl. Kaiser Honorius erklärte Anfang des 5. Jahrhunderts das offizielle Ende der blutigen Schauspiele. Doch der Widerstand des Volkes gegen diese kaiserlichen Entscheide blieb beträchtlich. Im Jahre 404 sprang daher der Mönch Telemachus in die Arena des Kolosseums, um gegen das grausame Treiben zu protestieren. Der Gottesmann erhob seine Stimme und forderte dazu auf, von dem frevlerischen Tun abzulassen. Das Volk geriet bei seinen Worten in Wut und steinigte ihn. Noch über hundert Jahre blieben das Kolosseum und viele andere Amphitheater entgegen offizieller kaiserlicher Weisung in Gebrauch. 483 berichtete der Kirchenvater Augustinus nach einem Besuch der Ewigen Stadt, er habe noch immer die Schreie der Menschen im Ohr, die Tötet ihn, tötet ihn riefen. Im Jahre 523 fanden im Kolosseum zum letzten Mal Kämpfe statt. Anlass dieser letzten Spiele war der Amtsantritt des Konsuls Maximus gewesen, der dafür eigens die Erlaubnis des in Ravenna residierenden Gotenkönigs Theoderich des Großen (Dietrich von Bern) eingeholt hatte. 536 verbot König Totila für sein ganzes Reich (Italien) die noch immer geduldeten Tierhatzen. Das einstige Prunkstück kaiserlicher Machtentfaltung musste, nachdem es für den ursprünglichen Zweck nicht mehr zur Verfügung stand, seinen Tribut an die Zeit zahlen. Es verkam zur Ruine. Große Erdbeben wie jene der Jahre 847 und 1231 begünstigten diese Entwicklung. 1244 wurden in den Arkaden Wohnungen und Werkstätten eingerichtet. Doch schon im Jahre 1300 wurden diese durch ein erneutes schweres Erdbeben völlig zerstört. Während des ganzen Mittelalters nutzten die Baumeister in der Ewigen Stadt die Ruinen der antiken Monumente als Steinbrüche. Auch dem Kolosseum blieb dieses Schicksal nicht erspart. Im Pontifikat Nikolaus V. (1447-1455) sollen an die 2.500 Wagenladungen Steine von dort in den Vatikan gebracht worden sein. 1675 wurden im Amphitheater Lagerräume für eine Pulverfabrik untergebracht. Als achtundzwanzig Jahre später ein Erdbeben große Teile des ersten und zweiten Stockwerks einstürzen ließ, nutzte man das Material für die Errichtung des Porto di Ripetta. Wenn auch die Päpste die gewaltige Ruine in der Vergangenheit für den Bau von Kirchen und Palästen in Anspruch genommen hatten, so war es doch letztlich ihnen zu verdanken, dass einer völligen Zerstörung des Kolosseums Einhalt geboten wurde. Denn es kam der Zeitpunkt, an dem dieser Ort als bedeutende Stätte des christlichen Martyriums angesehen wurde. Über die Zahl der dort ermordeten Gläubigen lassen sich keine gesicherten Erkenntnisse aufstellen. Dass Tötungen von Christen im Kolosseum stattfanden ist heute unbestritten, jedoch werden sie nicht in dem gewaltigem Maße erfolgt sein wie beispielsweise in dem auf dem ager vaticanus gelegenen Circus des Nero. Die damnatio ad bestias, die gegenüber Angehörigen der für die Römer so neuen und suspekten Religion ausgesprochen wurde, ist von den Quellen her eindeutig belegt. Aus der Apologie des Tertullian kennen wir den Ausspruch Christiani ad leonem Die Christen dem Löwen zum Fraß!. Im 17. Jahrhundert war der Gedanke aufgetaucht, den Bildhauer und Architekten Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) zu bitten, das Kolosseum in ein riesiges Gotteshaus umzuwandeln. Das Projekt wurde jedoch fallen gelassen. 1744 befahl Benedikt XIV. (1740-1758), in der Mitte der Arena ein großes Holzkreuz aufstellen. Im Heiligen Jahr 1750 bat der heilige Leonardo da Porto Maurizio, der große Prediger aus dem Franziskanerorden, Papst Benedikt XIV., in der antiken Kampstätte Kreuzwegstationen errichten zu lassen. Der Heilige Vater stimmte zu, und im Kolosseum wurde erstmals die Via Crucis gebetet. 1756 erklärte der Papst das Flavische Amphitheater zur Gedächtnisstätte des christlichen Martyriums und weihte es der Passion Jesu Christi. Es sollte ein Mahnmal für all jene Gläubigen der Welt werden, die ihr Bekenntnis zum wahren Gott mit ihrem irdischen Leben bezahlt hatten. Im 19. Jahrhundert waren es die Päpste, die viel zur Restaurierung und Erhaltung des antiken Monuments beitrugen. Nach der unrechtmäßigen Einnahme des Kirchenstaates im Jahre 1870 ließ die damalige kirchenfeindliche Regierung Italiens die Kreuzwegkapellen abreißen, führte jedoch die Restaurierungsarbeiten am Kolosseum weiter. 1929, unmittelbar nach den Lateranverträgen, die zur Aussöhnung des Heiligen Stuhls mit dem Königreich Italien führten, errichtete man erneut das Kreuz in der Arena des Flavischen Amphitheaters; im selbem Jahr fanden dort auch wieder Kreuzwegprozessionen statt. Heute wird jedes Jahr der Kreuzweg, den der Papst am Karfreitag mit vielen tausend Gläubigen beim Kolosseum betet, in Mondovision und über viele Rundfunksender ausgestrahlt. Millionen von Menschen erhalten so die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Heiligen Vater des Leidens unseres Herrn Jesus Christus zu gedenken und auch die Erinnerung an die Blutzeugen der ersten christlichen Jahrhunderte aufrecht zu erhalten. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuMärtyrer
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
