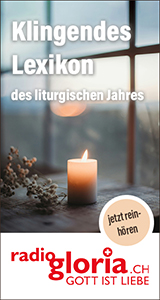SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- ADIOS!
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- Debatte um Leitung der Deutschen Bischofskonferenz - Lehramtstreue Bischöfe als „Königsmörder“?
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- Vatikan dementiert Bericht über Abweisung Macrons durch den Papst
- Papst Leo sendet kraftvolle Grußbotschaft an die Teilnehmer des „Marsch für das Leben“/Washington
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- THESE: Und die Bibel hat doch Recht!
- „Catholic Herald“: „Irlands schwindende Familien“
- US-Vizepräsident Vance wird erneut beim „March for Life“ teilnehmen und sprechen
- Katholikin Eva Vlaardingerbroek verliert Einreiseerlaubnis nach Großbritannien
- L'Avvenire sorgt für Confusione!
| 
Ökumenische Begegnungen zwischen Rom und Konstantinopel27. August 2025 in Kommentar, 1 Lesermeinung
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Konzil von Nizäa, dessen 1700-jähriges Jubiläum 2025 begangen wird, erinnert an gemeinsamen Ursprung des Glaubens. Papst Leo XIV. und Patriarch Bartholomaios I. wollen dort gemeinsam beten. Gastbeitrag von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer
Eichstätt (kath.net)
1. Ein Neubeginn aus dem Geist der Versöhnung
Die Jahrhunderte lange Trennung zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche war nicht nur durch theologische Differenzen, sondern auch durch ein tiefes kulturelles und politisches Misstrauen geprägt. Doch mit der epochalen Begegnung zwischen Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras I. in Jerusalem am 5. Januar 1964 begann ein neues Kapitel. Diese Umarmung – in der Stadt, wo Jesus gelitten, gestorben und auferstanden ist – war eine theologisch wie spirituell kraftvolle Geste. Die spätere gegenseitige Aufhebung der Exkommunikationen von 1054 (im Jahr 1965) markierte einen historischen Wendepunkt. Sie eröffnete nicht nur einen Weg des Dialogs, sondern ein neues Zeitalter des Miteinanders, das Papst Franziskus später als „Ökumene der Liebe“ bezeichnete.
In ihrer Erklärung von 1965 sprachen Paul VI. und Athenagoras davon, dass die Wunden der Vergangenheit nicht mehr als Hindernisse, sondern als Mahnungen betrachtet werden sollten. Die Geste des Bruderkusses wurde zur Ikone einer spirituellen Wiederannäherung. Damit war der Grundstein gelegt für einen Prozess, der sich seitdem über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt hat – trotz aller Spannungen und Rückschläge, die folgten.
2. Die 'Wende' von 1989/90 – Herausforderung und Chance
Die politischen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1989/90 waren ein tiefer Einschnitt – nicht nur geopolitisch, sondern auch kirchlich. Unierte Kirchen, die unter sowjetischer Herrschaft jahrzehntelang unterdrückt worden waren, traten wieder in Erscheinung. Besonders die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine gewann an Sichtbarkeit. Diese Entwicklung wurde vom Moskauer Patriarchat häufig als feindlicher Akt verstanden. Der Vorwurf lautete: Die katholische Kirche betreibe Proselytismus, also aktives Abwerben von Gläubigen aus der Orthodoxie.
Rom wies diesen Vorwurf zurück, gleichzeitig war man sich im Vatikan bewusst, dass neue Spannungen entstanden. Patriarch Bartholomaios I. zeigte in dieser Phase hohe ökumenische Sensibilität und bemühte sich um eine ausgewogene Haltung. Der Streit um die Autokephalie der Orthodoxen Kirche der Ukraine, die 2019 durch das Ökumenische Patriarchat anerkannt wurde, spaltete die Orthodoxie tief. Rom hielt sich diplomatisch zurück, bemühte sich jedoch um Gesprächskanäle mit allen Parteien. Das vatikanische Staatssekretariat versuchte, moderierend zu wirken – ein Balanceakt zwischen pastoraler Verantwortung und politischer Klugheit.
3. Institutionalisierter Dialog: Theologie als Brücke
Im Jahr 1979 institutionalisierten Papst Johannes Paul II. und Patriarch Dimitrios I. den Gemeinsamen Internationalen Theologischen Dialog. Die darin erarbeiteten Erklärungen – von München (1982) über Bari (1987) bis Ravenna (2007) – dokumentieren eine systematische Annäherung zwischen beiden Kirchen. Insbesondere das Ravenna-Dokument setzte neue Maßstäbe, da es sich mit dem Spannungsfeld von Synodalität und Primat beschäftigte. Hier wurde erstmals ein universaler Primat anerkannt – wenn auch unter der Prämisse, dass dieser in Liebe und im Dienst an der Einheit ausgeübt wird.
Während die Orthodoxie ein Modell der synodalen Gleichberechtigung pflegt, sieht die katholische Kirche im Bischof von Rom ein konstitutives Element der Einheit. Das Ravenna-Dokument ermöglichte hier neue gemeinsame Denkansätze. Es wurde als Zeichen gewertet, dass auch schwierige Themen wie Autorität und Leitung in gegenseitigem Respekt bearbeitet werden können.
4. Die Rolle der Päpste – geistliche und theologische Führung
Die Päpste der jüngeren Kirchengeschichte haben den ökumenischen Prozess in jeweils eigener Weise geprägt. Papst Benedikt XVI. legte den Fokus auf die theologische Durchdringung der Beziehungen. Seine Aussagen zur apostolischen Sukzession und zur sakramentalen Gültigkeit orthodoxer Weihen schufen ein tiefes Vertrauen unter den Ostkirchen. Sein Besuch beim Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. in Istanbul im Jahr 2006 wurde von vielen als mutiges Zeichen gewertet: Der Bischof von Rom als Pilger im Osten, im Geist der Demut und Geschwisterlichkeit.
Papst Franziskus hingegen versteht Ökumene vor allem als gelebte Nachfolge Christi. Die Zusammenarbeit mit Patriarch Bartholomaios I. in sozialen, ökologischen und friedensethischen Fragen hat ökumenische Partnerschaft mit neuem Leben erfüllt. Ihre gemeinsamen Botschaften zum Schutz der Schöpfung, ihre Gebetsinitiativen und öffentlichen Auftritte machen deutlich: Die Zeit theologischer Isolation ist vorbei – die Kirchen bezeugen gemeinsam ihren Glauben in einer zerrissenen Welt.
5. Die Schwesterkirchen – Petrus und Andreas
Die Formel der 'Schwesterkirchen' bringt das tiefe Band zum Ausdruck, das die Kirche von Rom mit dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel verbindet. Die Apostelbrüder Petrus und Andreas – Begründer der beiden Kirchen – stehen sinnbildlich für eine Beziehung, die durch Geschichte, Glaube und Märtyrertum miteinander verwoben ist.
Papst Johannes Paul II. prägte diese Sichtweise nachhaltig, als er 2004 sagte: 'Unsere Kirchen, die sich so lange fremd waren, haben begonnen, sich wieder als Schwesterkirchen zu erkennen – nicht im Sinne politischer Gleichstellung, sondern in brüderlicher Liebe, gegründet auf das eine Fundament: Jesus Christus.' Diese Formel wurde in vielen Dokumenten aufgenommen und vertieft. Besonders eindrucksvoll ist das gemeinsame Statement von Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios 2014: 'Unsere heutige brüderliche Begegnung ist ein erneuter Schritt auf dem Weg zur Einheit, zu der allein der Heilige Geist uns führen kann.'
6. Neue Impulse unter Papst Leo XIV.
Mit der Wahl von Papst Leo XIV. im Mai 2025 begann eine neue Etappe der ökumenischen Beziehung. Seine erste Begegnung galt dem Ökumenischen Patriarchen, der persönlich an der Inauguration in Rom teilnahm – ein Zeichen außergewöhnlicher Nähe. Schon bei dieser Begegnung sprach Papst Leo von einem 'Band der Liebe und Hoffnung', das Rom und Konstantinopel verbinde.
Wenig später empfing er eine orthodoxe Delegation zum Apostelfest (29./30. Juni). In Castel Gandolfo traf er im Juli 2025 eine orthodoxe Pilgergruppe aus den USA und betonte: 'Pilgerwege führen nicht nur zu heiligen Stätten – sie führen uns zueinander.' Seine Ankündigung, zur 1700-Jahr-Feier des Konzils von Nizäa zu reisen, unterstreicht den Willen zur geschwisterlichen Verbundenheit. Bartholomaios hatte bereits den 30. November 2025 als möglichen Begegnungstermin ins Auge gefasst.
7. Spirituelle Ökumene – Einheit im Gebet
Die größte Nähe entsteht nicht im Lehramt, sondern im Gebet. Die 'spirituelle Ökumene', wie sie seit Jahrzehnten in Gemeinschaften wie Taizé, Bose, Chevetogne, Niederaltaich und Collegium Orientale, Eichstätt, gepflegt wird, öffnet Räume für Vertrauen und Freundschaft. Die Gebetswoche zur Einheit der Christen (18.–25. Januar), oft in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Patriarchat vorbereitet, ist ein gelebtes Zeugnis dieser geistlichen Verbindung.
2023 wurde im Rahmen der Weltsynode die Initiative 'Together – Gathering of the People of God' ins Leben gerufen. Vertreter aller christlichen Kirchen versammelten sich zu einem ökumenischen Gebet auf dem Petersplatz – ein symbolischer Höhepunkt spiritueller Ökumene. Papst Franziskus sagte damals: 'Die Einheit ist nicht das Resultat diplomatischer Kompromisse, sondern eine Gabe Gottes, um die wir inständig bitten.'
6. Die Schwesterkirchen – Petrus und Andreas
Die Formel von den „Schwesterkirchen“ bringt auf den Punkt, was Papst Johannes Paul II. bereits 2004 ausdrückte: Rom und Konstantinopel, so lange getrennt, beginnen sich wieder als das zu sehen, was sie im Ursprung sind – zwei Kirchen mit gemeinsamer apostolischer Wurzel. Die Bezugnahme auf die Brüder Petrus und Andreas ist dabei mehr als symbolisch: Sie steht für eine Einheit in Vielfalt, in gegenseitigem Respekt und geistlicher Nähe.
Die jährlichen Delegationen zum Fest des Heiligen Andreas (in Konstantinopel) und zum Hochfest der Apostel Petrus und Paulus (in Rom) sind gelebte Zeichen dieser Verbundenheit. Die gegenseitigen Umarmungen, Segnungen und Gebete bezeugen: Die Trennung ist nicht mehr das letzte Wort. Die Kirchen erkennen einander als Ausdruck des einen Leibes Christi an.
7. Neue Initiativen unter Papst Leo XIV.
Mit dem Amtsantritt von Papst Leo XIV. 2025 wurde das Band zwischen Rom und Konstantinopel weiter gefestigt. Patriarch Bartholomaios I. nahm persönlich an der Inauguration in Rom teil – eine Geste von historischer Tragweite. Wenig später traf Papst Leo eine orthodoxe Delegation und betonte: „Wir streben keine Rückkehr zu alten Mustern an, sondern eine neue Form gelebter Communio.“
Papst Leo würdigte die Schritte seiner Vorgänger und erklärte seine Absicht, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Besonders hob er die geplante Reise zur 1700-Jahr-Feier des Konzils von Nizäa hervor, bei der er sich ein persönliches Wiedersehen mit Bartholomaios erhofft. Diese Pilgerreise solle ein 'konkretes Zeichen gelebter Einheit im Glauben' werden.
8. Historische Lasten – und deren Überwindung
Trotz Fortschritte bleiben die historischen Wunden präsent: z.B. die Plünderung Konstantinopels (1204) durch Kreuzfahrer oder die Primats-Erklärung auf dem Vaticanum I. (1870). Doch die Kirchen nähern sich dem Schmerz der Vergangenheit heute in einem neuen Geist – mit dem Willen zur Heilung und zur Überwindung alter Polemik.
Theologisch bestehen weiter Unterschiede im Verständnis von Kirche, Autorität und Sakramenten. Die katholische Kirche anerkennt jedoch ausdrücklich die apostolische Sukzession und die Sakramente der Orthodoxie – eine Sichtweise, die Papst Franziskus mehrfach bekräftigte. Wichtig ist dabei: Einheit wird nicht als Uniformität verstanden. Sie soll die legitime Verschiedenheit respektieren.
9. Spirituelle Ökumene und lokale Initiativen
Neben dem theologischen Dialog entfaltet sich eine tiefgehende spirituelle Ökumene. Gemeinschaften wie Taizé, Bose, Chevetogne, Niederaltaich oder das Collegium Orientale in Eichstätt schaffen Räume, in denen katholische und orthodoxe Christen gemeinsam beten, lernen und leben. Die geistliche Tiefe der orthodoxen Liturgie wirkt hier als bereichernd und inspirierend.
Auch auf nationaler Ebene ist die Ökumene lebendig: In Deutschland, Österreich, Frankreich, den USA und Polen gibt es zahlreiche Dialogkommissionen, in denen Bischöfe, Priester und Laien gemeinsam an Fragen der Einheit arbeiten. Der Vatikan unterstützt diese Initiativen bewusst, da aus ihnen tragfähige Modelle für die Weltkirche entstehen können.
10. Die Ökumene des Blutes und der Hoffnung
Ein besonders starkes Band entsteht im gemeinsamen Gedenken an die Märtyrer: orthodoxe, katholische und evangelische Blutzeugen des 20. Jahrhunderts, die in Konzentrationslagern, Gulags oder durch religiöse Verfolgung ihr Leben ließen. Papst Johannes Paul II. nannte sie eine „Ökumene der Heiligen“.
Am 23. März 2023 wurde in der Krypta der Basilika San Bartolomeo all’Isola, auf der Tiberinsel, in Rom, eine Gedenkstätte für die neuen Märtyrer eröffnet, ausdrücklich auch für nichtkatholische Christen. Solche Zeichen zeigen: Das gemeinsame Zeugnis wiegt schwerer als die institutionelle Trennung. Wie Papst Franziskus sagte: „Die Märtyrer aller Konfessionen sind das prophetische Zeichen der Einheit.“
11. Der Weg vor uns: Dialog als Berufung
Die Einheit der Kirche ist kein Projekt, sondern eine Berufung. Sie lässt sich nicht planen, sondern muss geistlich empfangen werden. Der ökumenische Weg lebt von Geduld, Treue und der Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes.
Das Konzil von Nizäa, dessen 1700-jähriges Jubiläum 2025 begangen wird, erinnert an den gemeinsamen Ursprung des Glaubens. Papst Leo XIV. und Patriarch Bartholomaios I. wollen dort gemeinsam beten – als Nachfolger von Petrus und Andreas, im Gedenken an die Einheit der einen Kirche.
Die Schwesterkirchen – Rom und Konstantinopel – stehen heute nicht am Ende, sondern am Anfang eines neuen Abschnitts. Der Weg ist lang, aber das Licht von Jerusalem 1964 leuchtet weiter. Es ruft zur Neubesinnung, zur Umkehr, hin zu einer geistlichen Einheit, zu einem brüderlichen Miteinander – in Christus.
Papst Leo XIV. mahnt (17.07.25) zu einem reifen Umgang in der Ökumene: „Rom, Konstantinopel und alle anderen Bischofssitze sind nicht dazu berufen, um den Vorrang zu wetteifern“, andernfalls ähnelten beide Seiten den Jüngern, die „selbst dann, als Jesus sein bevorstehendes Leiden ankündigte, darüber stritten, wer von ihnen der Größte sei“. Spirituell sollten Katholiken wie Orthodoxe „nach Jerusalem zurückkehren, in die Stadt des Friedens, wo Petrus, Andreas und all die übrigen Apostel“ zu Pfingsten den Heiligen Geist empfingen und „von dort her Christus bis an die Enden der Welt bezeugten“. 
Über den Autor: Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer (Link) ist Theologe mit Schwerpunkt auf ökumenischer Theologie, Ostkirchenkunde und ostkirchlicher Liturgie. Er studierte in Eichstätt, Jerusalem und Rom, war in verschiedenen Dialogkommissionen tätig, Konsultor der Ostkirchenkongregation in Rom, Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt und veröffentlicht regelmäßig zu Fragen der Ostkirchen-Theologie, der Liturgie der Ostkirchen und des Frühen Mönchtums.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Lesermeinungen| | gebsy 27. August 2025 | |  | Liebende Ökumene "Die geistliche Tiefe der orthodoxen Liturgie wirkt hier als bereichernd und inspirierend."
Das in Demut zu erkennen, ist ein wesentlicher Akt ökumenischer Liebe ... | 
2
| | |
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 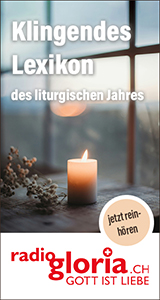





Top-15meist-gelesen- ISLAND-REISE - KOMMEN SIE MIT! - Eine Reise, die Sie nie vergessen werden!
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- ADIOS!
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- Debatte um Leitung der Deutschen Bischofskonferenz - Lehramtstreue Bischöfe als „Königsmörder“?
- Oktober 2026 - Kommen Sie mit nach SIZILIEN mit Kaplan Johannes Maria Schwarz!
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- Große kath.net-Leserreise nach Rom - Ostern 2027 - Mit P. Johannes Maria Schwarz
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Kardinal Zen: Papst Leo „ist wahrlich eine Leitungspersönlichkeit, die zuhören kann!“
- Katholikin Eva Vlaardingerbroek verliert Einreiseerlaubnis nach Großbritannien
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
- Sterilisationen, schlechte Lebensbedingungen: Grönländer kritisieren dänische Herrschaft
- Entfremdung und Annäherung – Für einen Katholiken in Deutschland gibt es doch immer noch Rom
|