 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Ein adventlicher Gottesdienst mit Christmas Carols in der romanischen Dorfkirche von Marval9. Dezember 2025 in Spirituelles, keine Lesermeinung Englische religiöse Kultur mitten in Frankreich. Von Lothar C. Rilinger Hannover (kath.net) Marval, ein kleines Örtchen im Südwesten des Departements Haute-Vienne, liegt verschlafen an der Grenze zur Dordogne. Nur eine Handvoll Häuser säumen die Straße und nur noch wenige Menschen leben hier. Ein Großteil der Häuser steht leer, an ihnen prangt das Signum dieser Gegend „A vendre“ und das schon seit Jahren. Die Eigentümer leben irgendwo in der Weite des französischen Kulturkreises, oft tausende Kilometer von diesem Flecken entfernt. Sie haben den Ort verlassen müssen, da er ihnen kein Brot und keine Arbeit mehr bot. Irgendwo in der Ferne leben sie und hoffen, dass sich jemand findet, der ihre Häuser übernimmt und die Fenster abdichtet, die im Wind klappernden Fensterläden arretiert und die Häuser wieder mit Leben erfüllt. Kein Haus ist abgesperrt und doch kommt nichts abhanden. Tritt man in diese Häuser ein, erscheint es, als wenn die Bewohner fluchtartig ihr Heim verlassen hätten. Noch steht das Geschirr auf dem Tisch, eine halb gefüllte Weinflasche, ein zu Stein gewordenes Baguette, in den Schränken hängen noch die Kleider und an den Wänden Fotografien, die letzten Erinnerungen an die, die dieser Bleibe den Rücken gekehrt haben. Ab und an nehmen sich einige Briten und auch Deutsche dieser Häuser an, versuchen zu retten, was noch zu retten ist, restaurieren, renovieren und hauchen so diesem Ort neues Leben ein. Sie versuchen, diesem Verfall Einhalt zu gebieten, doch nicht immer gelingt es ihnen. So mancher neue Eigentümer musste aufgeben, und nun warten diese Häuser wiederum auf jemanden, der sie aus ihrem Schlaf aufwecken wird. Den Mittelpunkt dieses Ortes aber bilden ein Chateau und eine Kirche, die eine Einheit darstellen und die beide aus dem Beginn des letzten Jahrtausend stammen. Sie hängen nicht nur baulich zusammen, in den großen Umwälzungen der französischen Geschichte waren sie vereint, und das Schicksal beider Gebäude ist so ähnlich. Das Chateau strahlt nichts Monumentales aus, nichts gar Imperiales, es ist eher ein großes Landhaus, das sich bescheiden an die romanische Kirche anschmiegt. Und doch verkehrten in diesem Hause die Großen Frankreichs, als sie hier auf dem beschwerlichen Weg nach Santiago de Compostella rasteten. Auch sie waren fromme Pilger auf dem Jakobsweg, immer auf der Suche nach Gott. Eleonore von Aquitanien, die zuerst mit dem König von Frankreich und dann mit dem von England verheiratet war und die Richard Löwenherz gebar, machte hier Rast, ebenso Katharina Medici, Anna von Österreich und König Franz I. Sie alle hielten Einkehr, um sich auszuruhen für das große Ziel, das noch hunderte von Meilen vor ihnen in der Ungewissheit lag. Doch auch andere Personen kamen und wollten in diesem Chateau Quartier nehmen, allerdings nicht friedvoll, nicht als fromme Pilger, die unter dem Zeichen der Jakobsmuschel Zuflucht suchten. Der Anführer der Hugenotten Admiral de Coligny machte hier auf seinem Feldzug gegen die alte Religion Station, und da er alles aus dem Wege räumen wollte, was sich seiner Idee entgegenstellte und da sich die Bewohner von Marval nicht dieser neuen Lehre unterwerfen wollten, trieb er über 250 Bewohner dieses Fleckens in die Kirche, ließ sie dort im Angesicht des Allerheiligsten kaltblütig ermorden und brannte dann das Chateau und die Kirche nieder. In dieser Raserei starben Menschen, die an die Heiligkeit der Kirche glaubten und die meinten, unter dem Schutz der Kirche ihres Lebens sicher zu sein. Doch auch der Glaube an denselben Gott hinderte Coligny nicht, im Angesicht Gottes die Menschen an seinem Ort zu töten. Und ein weiteres Mal wurde dieser Ort heimgesucht. Diesmal sollten die Angriffe nicht durch die Anrufung Gottes gerechtfertigt sein, diesmal musste die Vernunft herhalten, um mordend eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. In der Schreckensherrschaft nach der Französischen Revolution, in der Robespierres nur vernichten, nichts aber aufbauen wollte, wurde der Ort wiederum heimgesucht. In der Jagd auf die Angehörigen des ancien regime wurden nicht nur die Besitzer des Chateaus und ihre Parteigänger verfolgt, auch die Priester, die aus den Kirchen gezerrt wurden, um sie dann einer johlenden, dem Blutrausch verfallenden Masse vorzuwerfen. Im Chateau wird ein Schrank gezeigt, einer, der aus dem für die Gegend so typischen Kirschholz gearbeitet worden ist und der so groß ist, dass sich Menschen darin verstecken konnten. Auch ein Priester nahm in diesem Schrank Zuflucht und versteckte sich vor den Schergen der Revolution. Immer wieder suchten sie ihn, doch erfolglos. Bis dann der 6. Thermidor das Ende dieser Schreckensherrschaft brachte. Dieser Priester überlebte, während andere auf der Place de la Concorde in Paris unter der Guillotine ihr Leben verloren. Die Kirche, in der all´ dies Schreckliche passierte, liegt ungerührt in der brennenden Mittagssonne. Quietschend öffnet sich die mit Nagelköpfen beschlagene Tür, und der Besucher tritt in einen Raum, der dem Frieden dienen sollte, der aber einer des Krieges war. Die Schreie der Ermordeten, das Flehen und Bitten der Opfer, das Beten der Verwundeten ist noch in diesen uralten Mauern eingeschlossen. Sie sind eingedrungen im Laufe der Zeit, untilgbar verquickt mit der Geschichte dieses heiligen Ortes. Und Ehrfurcht erfasst den Besucher, Ehrfurcht und Trauer für diese Märtyrer des Glaubens, diese unbekannten Menschen, die Zeugnis für Gott abgelegt haben und dafür von denjenigen getötet worden sind, die meinten, ebenfalls im Sinne und Auftrage desselben Gottes handeln zu müssen. Derselbe Gott und doch diese tödliche Feindschaft – für uns Nachgeborene unfassbar und unbegreiflich. Keine Tafel erinnert an diese Tragödie, keinen noch so kleinen Hinweis erblickten wir. Man möchte sich wohl nicht an diese schwarzen Stunden der französischen Geschichte erinnern, und man möchte auch nicht hieran erinnert werden, sie sind nur Zwischenstationen auf dem Weg zur französischen Zivilisation, die ja konstitutive Grundlage nicht nur der Gesellschaft, sondern auch des Staates ist. Nur im Chateau wird hierüber gesprochen, hier wird die Erinnerung wach gehalten, weil auch diese dunklen Stunden zur Tradition gehören und weil in dem Chateau Geschichte nicht selektiv, sondern umfassend gedacht wird, auch wenn hierdurch der Ruhm Frankreichs ein wenig eingetrübt werden sollte. Die Kirche ist fast eintausend Jahre alt, fast vollständig hat sie die Zeitläufe überstanden. Nur das Gewölbe im Hauptschiff scheint eingestürzt gewesen zu sein. Eine flache Decke schließt jetzt das Hauptschiff nach oben ab, unorganisch und fremd – als wenn die Modernität in diese Kirche Einzug gehalten hätte, in der es so schwierig scheint, Größe und Höhe zu ertragen. Doch diese herabgezogene Decke vermittelt nicht Geborgenheit und auch nicht das Bekannte eines kleinen Raumes, sie wirkt nur drückend. Lieder und Gebete haben es schwer, in diesem Raum emporzusteigen, die Begrenzung ist zu nah, zu abrupt und auch viel zu brutal. Wie anders dagegen die Decke im Chor. Dort hat das Gewölbe die Zeit überstanden und das Himmelstürmende der Architektur späterer Jahrhunderte scheint hier ein wenig antizipiert zu sein. Hoch ragt kuppelartig der Altarraum, hoch zu Gott, hier können die Gebete gen Himmel steigen. Doch auch in dieser Kirche stießen wir auf die Diskrepanz zwischen Architektur und Inneneinrichtung, zwischen dem, was aus dem tiefen Mittelalter zu uns gekommen ist, und dem, mit dem die Menschen die Kirche nach der Revolution ausgestaltet haben. Die Inneneinrichtung ist karg, doch funktionsgerecht und das ist vielleicht das Wichtigste. Kein Schmuck lenkt den Blick auf den Altar ab, nur die wuchtigen Mauern wirken, und nur sie manifestieren den Anspruch, eine Burg Gottes darzustellen. Diese Kirche soll kein Museum sein, die nur wegen der Kunst aufgesucht wird. Sie soll vielmehr Mittelpunkt der Gemeinde sein, Treffpunkt für das gemeinsame Gebet. Und dazu reichen das Ewige Licht, ein paar Bänke, ein paar Gebetbücher und – die Frömmigkeit der Gläubigen. Ab und an finden hier Gottesdienste statt, doch nicht regelmäßig. Ein Priester muss mehrere Pfarrbezirke versorgen, die mehrere Dutzende von Kilometern auseinander liegen, und so zelebriert er an verschiedenen, weit auseinander liegenden Orten die sonntägliche Messe, doch immer mit fast denselben Gläubigen, die weite Strecken zurücklegen, um mit dem Priester Sonntag für Sonntag eine Messe feiern zu können. Und durch diese Reise wird der Priester wieder zum buchstäblichen Hirten, der mit seinen Schäflein von Hutung zu Hutung zieht. Mit einem ganz besonderen spirituellen Erlebnis verbinde ich diese in der Einsamkeit gelegenen Kirche. Im südlichen Limousin leben viele Engländer, die ihre englische Lebensart auch in Frankreich zelebrieren. Obwohl viele von ihnen der französischen Sprache mächtig sind, auch wenn einige damit hadern, dass die Franzosen kaum Englisch sprechen, bilden sie gleichwohl eine verschworene Gemeinschaft, in der sie ihre heimatliche Kultur leben können. Die sonntägliche Messe wird von Frauen aus dem Vereinigten Königreich und aus den Niederlanden musikalisch gestaltet. Schön ist es immer, wenn die Engländerin Mary zur Kommunion eines der so melodiösen englischen Kirchenlieder singt, manchmal sogar gemeinsam mit ihrer Tochter, und der Gemeinde erhebende Momente schenkt, die die Gebrauchsmusik, die ja vom Konzil für die kleinen Dorfkirchen eingefordert wird, in den Hintergrund treten lässt. Als wir vor einem Vierteljahrhundert ins Limousin gegangen sind, murrten einige Gläubige über diese fremden englischen Lieder, doch inzwischen sind sie zum integralen Bestandteil der Messe geworden und werden als Bereicherung empfunden. An diese englische Kirchenmusik musste ich denken, als ich in einer früheren Vorweihnachtszeit auf den Hinweis stieß, dass die englische Gemeinschaft in der Kirche von Marval zu Christmas Carols einlud. Da ich in den musikalischen Erinnerungen des vormaligen britischen Premierministers Edward Heath einiges über diese Form der Weihnachtsfeier gelesen habe, war ich neugierig, diese typisch britische Kultur kennenzulernen. Die Gläubigen drängten sich in der kleinen romanischen Kirche, englische und ab und an auch französische Sprachfetzen unterbrachen zuweilen die feierliche Stille und als der französische Gemeindepriester, angetan mit den liturgischen Gewändern, die Kirche, die uns durch das warme Kerzenlicht in eine vorweihnachtliche Stimmung zog, betrat, erhoben sich die Gläubigen und stimmten eines dieser melodiösen englischen Kirchenlieder an. Es war kein Konzert, keine Aufführung – es war ein vorweihnachtlicher Gottesdienst, eine Andacht für Gläubige, die durch das Beten und Singen vergessen wollten, in der Fremde zu leben. Der Kirchenraum war vom Gesang erfüllt, die kleine Orgel, eher ein Harmonium, kämpfte gegen die Stimmen, um auch gehört zu werden, – gegen die Inbrunst, mit der die Gemeinde ihren Glauben bezeugte, und die nahende Ankunft Christi, dieser Advent, erfasste auch uns. Der Priester zelebrierte die Andacht, die aber immer wieder unterbrochen wurde, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und verschiedene musikalische und folkloristische Darbietungen vortragen zu lassen. Ein alter, eleganter Opernsänger, der seine große Zeit in London und auf anderen bedeutenden Bühnen der Welt erlebt hat und jetzt seinen Lebensabend im Limousin genießt, sang ein Lied von Händel; der Organist verließ seinen Platz an der Orgel und trug eine Weihnachtsgeschichte in der Sprache des alten Frankreichs, dem Okzitanischen, vor – in einer Sprache, die immer noch von der alteingesessenen französischen Landbevölkerung gesprochen wird; einige englischen Kinder sangen und ein Quartett spielte religiöse Weisen. Nach jeder Darbietung hörten wir eine Epistel oder das Evangelium, die der Priester auf Französisch vortrug, ebenso die Predigt, in der er das Verbindende durch die Kirche hervorhob, dieses Transzendieren der Grenzen, das Gemeinsame, für das Jesus Christus steht. Nach dem Schlusssegen, den der Priester erteilte, erhoben sich die Gläubigen, die Orgel stimmte das Vorspiel an und dann fiel die Gemeinde ein, um das vielleicht schönste Weihnachtslied zu singen: Silent night, holy night. Die zweite Strophe wurde auf Französisch gesungen Douce nuit, sainte nuit und die dritte auf Deutsch. Die Worte Stille Nacht, heilige Nacht erfüllten den Raum – es war mir, als wenn gerade die deutschen Worte mit besonderer Hingabe gesungen wurden. Dieses Lied war die Hymne, ein weihnachtliches anthem, das die britische Heimat in der französischen Provinz für ein paar Momente erstehen ließ und es war der Ausdruck einer Verbundenheit mit Jesus Christus, die sogar der britische Besatzungsoffizier Edward Heath in der Weihnachtsmette 1945 in Osnabrück verspürte und in ihm – wie er bekannte – die Hoffnung habe aufkommen lassen, dass die Grenze zwischen Sieger und Besiegten im Namen des geborenen Heilands niedergerissen werden und eine Form der Vernunft die Welt erfassen könne, die uns den Frieden bescheren möge. Gleichzeitig ließ dieses Lied uns aber auch hoffen, dass in diesem so lautstark vorgetragenen Bekenntnis der atheistische Laizismus, der Frankreich und den Westen im Würgegriff hält, überwunden werden könne. Die christliche Tradition ist nun einmal die Kultur, die Europa hat groß werden lassen. Was als ein Konzert angekündigt worden war, war wie eine Messe – eine vorweihnachtliche Begegnung mit Gott, und deshalb war es auch selbstverständlich, dass der Priester die feierliche und besinnliche Liturgie nicht dadurch zerstörte, dass er – sehr bürgerlich und wenig liturgisch – den Mitwirkenden dankte und die Gläubigen aufforderte, Beifall zu klatschen, schließlich sind Carols in Melodien gefasste Gebete. Als wir die Kirche verließen, traten wir wieder in die so andere Welt des Laizismus. Bunte Weihnachtsmänner sollten auf die in Kürze staatlicherseits angeordneten freien Tage hinweisen, blaue Lichter und kitschige Figürchen an kleinen Fichten sollten auf diese Zeit hinweisen, bunte Girlanden überspannten die Straßen. Doch wir waren erfüllt von den spirituellen Momenten, von der tiefen Frömmigkeit der Briten, von dem Willen, den Glauben zu zeigen und für Gott zu kämpfen. Selbst im Limousin, dem Kernland des Laizismus und des Atheismus, gibt es immer wieder Momente, die uns daran glauben lassen können, dass Gott nicht tot ist, sondern immer noch seine Verfechter hat, immer noch Gläubige, die die Flagge Christi hochhalten und treu zu ihm stehen. Lothar Rilinger (siehe Link) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht i.R., stellvertretendes Mitglied des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes a.D., und Autor mehrerer Bücher. kath.net-Buchtipp: Foto: Kirche von Marval (c) Lothar C. Rilinger Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuAdvent
|     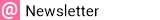 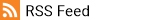 Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
