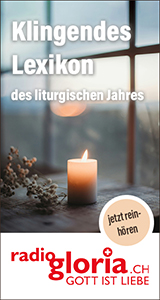SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- ADIOS!
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- Debatte um Leitung der Deutschen Bischofskonferenz - Lehramtstreue Bischöfe als „Königsmörder“?
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- Vatikan dementiert Bericht über Abweisung Macrons durch den Papst
- Papst Leo sendet kraftvolle Grußbotschaft an die Teilnehmer des „Marsch für das Leben“/Washington
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- THESE: Und die Bibel hat doch Recht!
- „Catholic Herald“: „Irlands schwindende Familien“
- US-Vizepräsident Vance wird erneut beim „March for Life“ teilnehmen und sprechen
- Katholikin Eva Vlaardingerbroek verliert Einreiseerlaubnis nach Großbritannien
- L'Avvenire sorgt für Confusione!
| 
Zwischen Sehnsucht und Stille6. Juli 2025 in Aktuelles, 2 Lesermeinungen
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Warum die Kirche der Zukunft eine hörende Kirche sein wird. Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer
Eichstätt (kath.net) 1. Von der Krise zum Kairos – Hören als geistliche Wende
Die Diagnose ist bekannt: Kirche verliert an Relevanz, an Vertrauen, an Bindungskraft. Doch diese Krise ist nicht das Ende. Sie ist ein Kairos – ein geistlich zu deutender Moment. In der scheinbaren Leere liegt auch ein Raum: ein Raum für Gottes Wirken.
Nicht Aktivismus, nicht Optimierung ist jetzt gefragt – sondern Unterscheidung. Nicht die Beschleunigung kirchlicher Reformprozesse wird den Wendepunkt bringen, sondern eine Rückkehr zum Wesentlichen: zum Hören auf das Evangelium, auf die Menschen, auf den Heiligen Geist.
Wenn die Kirche wieder eine hörende Kirche wird, kann sie in der Säkularität nicht untergehen – sondern neu aufblühen. Nicht als gesellschaftliche Macht, sondern als geistlicher Raum.
2. Was nicht mehr trägt – und was wachsen kann
Viele Strategien der letzten Jahrzehnte haben die strukturelle Seite der Krise betont – ohne die geistliche Tiefe zu berühren. Es ist Zeit, ehrlich Bilanz zu ziehen:
- Die Rückzugsstrategie auf fromme Enklaven mag spirituell gehaltvoll sein, bleibt aber gesellschaftlich randständig.
- Dogmatischer Exklusivismus verfehlt die Wirklichkeit religiöser Pluralität – und wirkt elitär statt einladend.
- Event-Pastoral zieht vielleicht Aufmerksamkeit auf sich, schafft aber kaum Verwurzelung. Die Frage lautet nicht: „Ist es attraktiv?“, sondern: „Ist es glaubwürdig?“
Und doch gibt es Räume, in denen Kirche wahrgenommen, gebraucht und geschätzt wird. Was zeichnet diese Orte aus?
• Seelsorge auf Augenhöhe: In Tauf-, Ehe- oder Trauergesprächen. Nicht als Belehrung, sondern als Begleitung.
• Spirituelle Erfahrungsräume: Pilgerwege, Exerzitien, Klosterzeiten – einfache Orte mit tiefer Resonanz.
• Gemeinschaft in kleinen Gruppen: Wo Menschen nicht gezählt, sondern gesehen werden.
• Gelebte Diakonie: Im Hospiz, in der Schule, bei der Tafel. Dort, wo Kirche nicht „verkündet“, sondern mitträgt.
Diese Formen wachsen nicht aus Konzepten, sondern aus Beziehungen – sie entstehen dort, wo das Evangelium in leiser Weise Gestalt gewinnt.
3. Kirche im Wohnzimmer – Neue pastorale Räume
Die Zukunft der Kirche ist nicht monumental – sondern relational. Der Pastoraltheologe Christian Bauer bringt es auf den Punkt:
Die Kirche von morgen wird eine „leicht gepackte Kirche“ sein.
Nicht der Kirchturm, sondern das Wohnzimmer.
Nicht die Sakristei, sondern der Küchentisch.
Nicht die Amtssprache, sondern das geteilte Brot.
Wo zwei oder drei versammelt sind – in Hauskreisen, Nachbarschaftsgebeten, Bibelabenden –, da geschieht Kirche. Die liturgische Mitte kann ein Esstisch sein, die Verkündigung ein Gespräch bei Kaffee. Das Evangelium braucht keine große Bühne – es braucht ein offenes Herz.
Solche „Wohnzimmerkirche“ ist keine Notlösung. Sie ist eine der neuen Formen der Nähe, der Authentizität und der Teilhabe. Nähe ersetzt Struktur – und Beziehung ersetzt Programm.
4. Theologie der Hoffnung – nicht der Verwaltung
Zu lange wurde Kirche in der Krise als Organisation betrachtet, die ihre Prozesse reformieren muss. Das stimmt – aber greift zu kurz. Kirche ist kein Verwaltungsapparat, sondern ein geistlicher Leib. Sie ist kein Reparaturbetrieb – sondern Sakrament: Zeichen und Werkzeug der Hoffnung, auch inmitten von Schwäche.
Wo Menschen einander zuhören, wo gemeinsam gebetet wird, wo das Wort Gottes geteilt wird, da wird Kirche neu gegenwärtig – auch ohne Budget, Titel oder Räume. Die Hoffnung, von der wir leben, ist nicht selbst gemacht. Sie wird uns geschenkt – aus dem Evangelium heraus.
Infos: Merkmale der Kirche von morgen
- Klein & überschaubar: Gemeinschaft statt Anonymität
- Wohnlich & alltagsnah: Kirche im Wohnzimmer
- Beziehungsorientiert: Seelsorge im direkten Miteinander
- Mobil & flexibel: Liturgie und Glauben unterwegs
- Gastfreundlich & offen: Einladende Haltung statt Hürden
- Hörend & betend: Präsenz statt Programm
Schlussgedanke: Kirche als Raum für Fragen und des Angenommen-Seins
Es geht: Ja, es geht heute scheinbar auch ohne Religion.
Aber: Es geht nicht ohne Sehnsucht.
Nicht ohne die Frage nach Sinn, Vergebung, Gegenwart.
Und genau dort beginnt die Aufgabe der Kirche von morgen:
Nicht zu überreden. Nicht zu überreden. Sondern mitzuhören. Mitzugehen. Mitzutragen.
Vielleicht ist die hörende Kirche der letzte Ort, an dem das Evangelium noch wirklich gehört werden kann – und neu gesprochen werden will. 
Kurzbiographie von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer: geb. 1949 in Altdorf/ Titting;1977 Priesterweihe; 1977-1985 Abtei Niederaltaich; Studien (Diplom, Lizentiat, Doktorat): Eichstätt, Jerusalem, Griechenland, Rom; 1991-1998 Pfarrseelsorge; 1998-2008 Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt; 2002 Erzpriester-Mitrophor; 2010 Archimandrit; 2004-2012 Päpstl. Konsultor für die Ostkirchen/Rom; 2008-2015 Rektor der Wallfahrt und des Tagungshauses Habsberg; 2011-2015 Umweltbeauftragter und 2014-2017 Flüchtlingsseelsorger der Diözese Eichstätt; seit 2017 Mitarbeit in der außerordentlichen Seelsorge.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 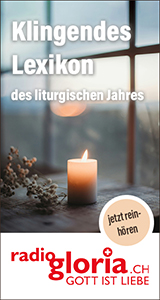





Top-15meist-gelesen- ISLAND-REISE - KOMMEN SIE MIT! - Eine Reise, die Sie nie vergessen werden!
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- ADIOS!
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- Debatte um Leitung der Deutschen Bischofskonferenz - Lehramtstreue Bischöfe als „Königsmörder“?
- Oktober 2026 - Kommen Sie mit nach SIZILIEN mit Kaplan Johannes Maria Schwarz!
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Große kath.net-Leserreise nach Rom - Ostern 2027 - Mit P. Johannes Maria Schwarz
- Kardinal Zen: Papst Leo „ist wahrlich eine Leitungspersönlichkeit, die zuhören kann!“
- Katholikin Eva Vlaardingerbroek verliert Einreiseerlaubnis nach Großbritannien
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
- Sterilisationen, schlechte Lebensbedingungen: Grönländer kritisieren dänische Herrschaft
- Entfremdung und Annäherung – Für einen Katholiken in Deutschland gibt es doch immer noch Rom
|