 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Der Traum vom gemeinsamen Ostern – Chancen und Probleme1. Juli 2025 in Chronik, 19 Lesermeinungen 1700 Jahre nach Nizäa: Wie Christen heute das Osterfest gemeinsam feiern könnten - Die Problematik ist weniger theologischer als vielmehr kalendarischer Natur. Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer Eichstätt (kath.net) Ein seltenes Ereignis fiel in diesem Jahr mit einem bedeutenden Jubiläum zusammen: 2025 feierten Christen weltweit am selben Tag das Osterfest und zugleich erinnern sie sich an das Erste Ökumenische Konzil von Nizäa im Jahr 325, dessen 1700. Jahrestag begangen wird. Das Konzil legte unter anderem die einheitliche Berechnung des Osterdatums fest, ein Vorhaben, das bis heute in der Praxis scheitert. Die Frage drängt sich auf: Ist es nicht an der Zeit, 1700 Jahre nach Nizäa das gemeinsame Osterfest Wirklichkeit werden zu lassen? Das Konzil von 325, das als erstes ökumenisches Konzil der Christenheit gilt, war bestrebt, Einheit zu stiften, sowohl im Bekenntnis (mit dem Credo von Nizäa) als auch in der Praxis (etwa durch die Vereinheitlichung des Osterdatums). Die Konzilsväter einigten sich darauf, Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern, ein Kompromiss zwischen östlicher und westlicher Tradition, der damals als große Einigung empfunden wurde. Die Problematik ist also weniger theologischer als vielmehr kalendarischer Natur. Und sie wird durch innerorthodoxe Spannungen noch verschärft: In der orthodoxen Welt besteht keine vollständige Einigkeit, wie mit dem Kalender umzugehen sei. Einige orthodoxe Kirchen (z. B. Griechenland, Rumänien, Bulgarien) haben den sogenannten revidierten Julianischen Kalender eingeführt, sie feiern Weihnachten also am 25. Dezember, halten aber für Ostern und alles, was damit zusammenhängt (von der Vorfastenzeit bis zum Allerheiligenfest, Sonntag nach Pfingsten) weiterhin am alten System fest. Andere, etwa die russische, serbische, jerusalemer und georgische Kirche, ebenso die altorientalisch-orthodoxen Kirchen (Kopten, Äthiopier, Syrer und Armenier) nutzen durchgehend den Julianischen Kalender. Dies und einige interorthodoxe politische Auseinandersetzungen erschweren bereits innerhalb der Orthodoxie eine Einigung über ein gemeinsames Festdatum, dazu kommt, dass ein ökumenisches Vorgehen mit Rom von einigen orthodoxen Hardlinern zusätzlich als erschwerend erachtet wird. Schon 1920 schlug das Ökumenische Patriarchat in seiner bahnbrechenden Enzyklika „An alle Kirchen Christi überall“ vor, einen einheitlichen Kalender für die großen Feste zu etablieren. Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras I. griffen die Idee in den 1960er-Jahren erneut auf, ohne nachhaltigen Erfolg. Auch das Zweite Vatikanische Konzil bekundete in Sacrosanctum Concilium (Nr. 110) die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Osterdatum. Und die Päpste Benedikt XVI., Franziskus und jetzt Leo XIV. sowie Patriarch Bartholomäus I. haben mehrfach signalisiert, dass sie zur Verständigung und einer gemeinsamen Lösung bereit wären. Die innerorthodoxe Debatte hat zuletzt 2016 auf dem „Heiligen und Großen Konzil“ von Kreta einen Rückschlag erlitten: Die Frage des gemeinsamen Osterfestes wurde zwar angesprochen, aber nicht entschieden. Zu stark waren die innerkirchlichen Vorbehalte, zu groß die Angst, die eigene Identität aufzugeben. Manche Kirchen sehen im Gregorianischen Kalender einen Ausdruck westlicher Dominanz und fürchten eine Preisgabe der eigenen Tradition. Auch heuer (2025) ist wieder ein Anlass, solche Lösungen neu zu bedenken. Die 1700-Jahr-Feier von Nizäa bietet einen symbolträchtigen Moment. Es wäre der ideale Zeitpunkt für eine kirchliche Initiative, nicht als Schnellschuss, sondern als wohlüberlegte Verpflichtung zu einem schrittweisen ernsthaften Wandel. Ein Vorschlag könnte sein, das Jahr 2025 als Ausgangspunkt zu definieren, um dann, etwa ab 2030, verbindlich ein gemeinsames Osterdatum einzuführen. Der Weg dahin müsste ökumenisch vorbereitet, innerkirchlich abgestimmt und pastoral gut begleitet werden. Ein solcher Prozess braucht Zeit, aber er ist bereits überfällig und duldet keinen Aufschub mehr. Nicht aus politischer Strategie oder pragmatischem Kalkül, sondern weil der Glaube an die Auferstehung alle Christen verbindet und Ostern allen gehört. 1700 Jahre nach dem Konzil von Nizäa ist die Zeit gekommen, diesem Glauben auch gemeinsam Ausdruck vor der Welt zu verleihen.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 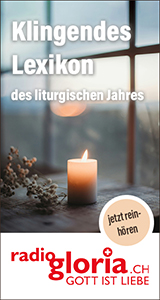      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
