 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Hier ist kein Glaube mehr zu finden17. März 2025 in Kommentar, 24 Lesermeinungen Die Krokodilstränen des Bischofs von Limburg werden ohne Folgen bleiben. Nur jammern, statt den Ursachen auf den Grund zu gehen und nach Alternativen zu suchen, führt nicht weiter. Der Montagskick von Peter Winnemöller Limburg (kath.net) Im Lukasevangelium stellt Jesus eine Frage, über die man in unseren Tagen mal nachdenken sollte: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde (noch) Glauben vorfinden?“ (Lk 18,8). Es scheint, als hätte die KMU 6 dem Herrn in unseren Tagen die Antwort gegeben. In seinem ansonsten nicht weiter bemerkenswerten Fastenhirtenbrief stellt der Bischof von Limburg folgendes fest: „Von daher macht es mir Sorgen, wenn bei der 2023 veröffentlichten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung die Zustimmung der Befragten zur Aussage: ‚Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat‘ im Vergleich zu vorherigen Befragungen dramatisch gesunken ist. Unter den katholischen Kirchenmitgliedern bejahen heute 32 Prozent diese Aussage.“ (Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2025 von Georg Bätzing, Bischof von Limburg, Lesefassung, S.5.) Erörterung und Schlussfolgerungen dazu sind flach und bleiben erwartbar im Trüben. Dabei ist die Fragestellung vor allem im Kontext der Erinnerung an das Credo von Nicäa und seine Entstehung, die im Zentrum des Hirtenbriefes stehen, keineswegs trivial. Machen wir uns klar, dass in Deutschland – je nach Zählweise – knapp oder weniger als 50 Prozent der Einwohner Christen sind. Bei den zu erwartenden Austrittszahlen kann inzwischen davon ausgegangen werden, dass es weniger als 20 Millionen Katholiken in Deutschland gibt. Nur ein Drittel, das sind knapp 6,7 Millionen katholische Menschen in Deutschland bekennen noch ihren Glauben, „dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“. Das sind bezogen auf die Gesamtbevölkerung gerade einmal 8 Prozent. Wenn man also durch eine belebte Fußgängerzone geht, dann gehört ungefähr jeder zwölfte Mensch, der einem begegnet zu diesen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Der Bischof von Limburg sorgt sich zu Recht, denn unsere gesamte Kultur in Westeuropa baut darauf auf, dass sich die Menschen zu Jesus Christus bekennen. Das heute gern geschmähte Abendland stand auf drei Beinen. Da ist die griechische Philosophie, die die Weise des Denkens der Menschen maßgeblich geprägt hat. Da ist das römische Recht, welches unser Rechtsempfinden bis heute prägt. Viele Rechtsgrundsätze in lateinischer Sprache wurden schon in der Antike so gedacht. Da ist der Glaube an Jesus Christus, wie ihn das Konzil von Nicäa ausformuliert hat. Schon lange wird die griechische Weise zu denken durch postmoderne Dekonstruktivisten mehr und mehr zerstört. Das Recht wie es lange gepflegt und überliefert war, existierte als konkretisierte Ausformulierung des natürlichen Rechts. Mehr und mehr dominiert in heutiger Zeit der Rechtspositivismus. Nun wird am Ende auch der gemeinsame Glaube der unsere Zivilisation getragen hat, abgebaut. Käme der Menschensohn heute nach Europa, so würde er den Glauben nur noch als fragmentierten Rest vorfinden. Die große Zeit des europäischen Kontinents geht zu Ende. Schon einem der großen Denker des vergangenen Jahrhunderts, Erik von Kuehnelt-Leddihn, war klar, dass der Glaube weitgehend verdunstet ist. Er bemerkte, dass wir heute nur noch vom „Geruch der leeren Flasche“ lebten. Selbst dieser ist inzwischen verdunstet. Zunehmend macht sich weltweit aber auch in Europa die Erkenntnis breit, dass es so nicht mehr weiter gehen kann. Nicht nur die wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Fragen drohen alle Errungenschaften der vergangenen Jahrhunderte wegzuspülen. Nicht nur die neue Völkerwanderung wird Europa im Laufe weniger Jahrzehnte komplett verändern. Es fehlt den Europäern eine Basis, auf der sie nach dem Niedergang neu aufbauen könnten. Es könnte zu einer kulturchristlichen Renaissance in Europa kommen, wie sie der Historiker David Engels beschreibt. Das hätte zur Folge, dass eine neue und letzte Blüte des Kontinents – ähnlich der antiken Pax Augusta – unserem Kontinent noch eine letzte Hochphase gewähren würde. Vieles spricht dafür, zumal der gegenwärtige Kulturnihilismus für keine der nach Europa einwandernden Gruppen wirklich anschlussfähig ist. Damit wird es umso bedeutender für die Kirche, die inneren Kreise entschieden zu stärken und nicht mehr auf die Illusion von Volkskirche zu setzen. Dafür lohnt sich hinzusehen, was die Sozialforscher nicht sagen. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung weicht nämlich in einem wesentlichen Punkt aus. Sie beschreibt Phänomene, doch sie verschließt systematisch die Augen vor den Ursachen. Gerade in Deutschland könnte man hier sehr genau hinsehen. Durch die zahlreichen monetären wie organisatorischen Verbindungen zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen könnte man viele aussagekräftige Daten gewinnen. Um hier nur ein Beispiel zu nennen: Der Religionsunterricht. Jeder katholische Schüler hat – so er sich nicht abmeldet – zehn (Abiturienten 12 oder 13) Jahre konfessionellen Religionsunterricht. Hier muss man gleich zwei Einwände ausräumen. Zum einen lernen viele Schüler französisch in der Schule und nur wenige können es sprechen. Zum anderen ist es natürlich so, dass Bildung keinen Glauben induziert. Dennoch sind die Schüler über mindestens ein Jahrzehnt zwei Mal in der Woche mit dem Thema katholische Religion befasst. Am Ende seiner Laufbahn als Schüler einer Mittelschule bekommt jeder Schüler mit wenig Nachdenken die höfliche Anrede „Bonjour Madame“ bzw. „Bonjour Monsieur“ auf die Reihe. Basics bleiben irgendwie immer hängen. Und so stellt sich die Frage, sie schon Papst Benedikt XVI. in seinem Buch „Licht der Welt“ formulierte: "Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. In Deutschland hat jedes Kind neun bis dreizehn Jahre Religionsunterricht. Wieso dann gar so wenig hängen bleibt, um es mal so auszudrücken, ist unbegreiflich. Hier müssen die Bischöfe in der Tat ernsthaft darüber nachdenken, wie der Katechese ein neues Herz, ein neues Gesicht gegeben werden kann." Wie oben schon beschrieben, weicht die KMU der Frage nach Ursachen aus. Es wäre in der Tat interessant, zu erfahren, was genau die Absolventen von katholischem Religionsunterricht bestimmter Klassenstufen sowie am Ende der Schullaufbahn überhaupt wissen. Nur 32 Prozent der Katholiken bekennen Jesus Christus, aber wie viele Katholiken wissen, was die Kirche über Jesus Christus lehrt? So muss man am Ende leider feststellen, dass an der einzigen Stelle, die im Hirtenbrief des Limburger Oberhirten bemerkenswert sein könnte, am Ende doch nur heiße Luft herauskommt. Es ist der Bischof, der in seiner Diözese den Religionslehrern die Missio erteilt. Warum achtet er als Bischof nicht auf seine Religionslehrer? Es ist der Bischof, der den Professoren, die Religionslehrer ausbilden, die Venia legendi erteilt. Warum achtet er nicht auf seine Professoren, die seine Lehrer und Priester ausbilden? Er ist Vorsitzender der Konferenz der Bischöfe. Warum geht von ihm nicht eine Initiative für einen besseren Religionsunterricht und eine bessere Katechese aus? Wo bitte schön bleibt die Initiative für eine breit angelegte Erwachsenenkatechese. An mindestens drei Punkten trifft die Kirche auf getaufte Ungläubige: Bei der Hochzeit, bei der Taufe und bei der Erstkommunion. An allen drei Stellen bietet sich ein Anknüpfungspunkt für eine ernsthafte Katechese. Es braucht allerdings etwas Mut. Denn hier wird die Kirche erleben, was der Herr erleben musste. „Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?“ (Joh 6,60) Und dann ist an den Bischöfen, die Gelassenheit zu haben, das zu ertragen: „Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher.“ (Joh 6,66) Ja, mehr noch, sie müssen den Mut finden alle verbliebenen zu fragen: „Wollt auch ihr weggehen?“ (Joh 6,67) Die Frage Jesu an dieser Stelle ist nichts als eine absurde Intervention, denn als Antwort kommt das Messiasbekenntnis des Petrus. Und auch heute würde das Messiasbekenntnis vieler kommen. Die Kirche ist der mystische Leib Christi. Zu wem sollten wir gehen, die Kirche hat Worte des ewigen Lebens. Doch müssen wir a) den Mut finden, die gehen zu lassen, die gehen wollen, weil sie den Glauben nicht ertragen und b) die Ehrlichkeit haben, jenen zu sagen, was sie verlassen. Nur so öffnen wir wirklich die Tür zu Bekehrung und Rückkehr. Absolventen des heutigen Religionsunterrichts – löbliche Ausnahmen bestätigen die Regel – wissen heute nach Ende der Schulzeit mehr über Buddhismus, Islam und Religionskritik als über den authentischen Glauben der Kirche. Ein Bischof, der diesen Makel erkennt und nicht entschieden handelt macht sich schuldig an gegenwärtigen und kommenden Generationen. Wir brauchen den Aufbruch in der Katechese. Wir brauchen eine Stärkung des Christusbekenntnisses. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir nie die Mehrheit sein werden, sondern dass es unsere Aufgabe ist, der Sauerteig einer Gesellschaft zu sein. Dazu brauchen wir mutige und entschlossene Hirten ebenso wie qualifizierte Katecheten für alle Altersstufen. Die päpstliche Weisung ein Katechetenamt einzuführen, war eine prophetische Weisung, die zeigt, was die Kirche schon heute und mehr noch in der Zukunft braucht. Nun bräuchte es noch den mutigen Schritt aus Rom die Qualifizierung von Katecheten in Ländern mit problematischer Hierarchie in geeignete Hände unter Aufsicht des Heiligen Stuhls zu legen. Es ist nämlich kaum anzunehmen, dass es in Deutschland ein breit angelegtes Ausbildungsprogramm für missionarische Katecheten geben wird. Wir müssen mit leer dahin geseufzten bischöflichen Worthülsen leben. Leider. Bild oben: Jesus hat seine Jünger nicht unwissend gelassen. Er hat sie gelehrt. Bergpredigt im Schwarzwald, Gemälde für die evang. Kirche in Reinerzau im Schwarzwald, um 1912, von Rudolf Yelin d.Ä. (1864-1940). Foto: Gemeinfrei Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuMontagskick
| 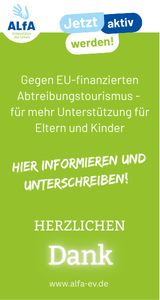       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
