 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
| 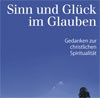 Schuld und Sünde überall aber nicht bei sich selbst13. Dezember 2008 in Buchtipp, keine Lesermeinung Exklusiv auf Kath.net im Dezember: Leseprobe aus dem Buch "Sinn und Glück" von P. Karl Wallner. Linz/Wien (www.kath.net) Wir brauchen die Beichte, um uns die Freude zurückzuerobern! Der genannte Brauch des Risus paschalis ist eine Art historischer Beweis, denn das liturgische Osterlachen entstand zu einer Zeit, in der sich die Beichte in großem Stil als persönliche Bußform durchsetzte. Nach der Bußhaltung der Fastenzeit und nach der Mühe der Beichte machte sich dann zu Ostern gleichsam kollektiv und explosiv die fröhliche Atmosphäre der Erlösung Luft. Die Gemeinde lachte; sie lachte, weil die Gläubigen in ihrer eigenen Umkehr erfahren hatten, wie gut Gott ist und wie schön ein versöhntes Leben sein kann. Die Beichte ist die Therapie Gottes gegen jede Form der Frustration seiner Gläubigen. Diese Therapie der seelischen Heilung setzt allerdings eines voraus: die Erkenntnis der Sünden und die Annahme dieser Sünden. Und das ist genau das, was uns heutigen Menschen nicht liegt: sich selbst und damit seine Schwäche anzunehmen! Von Anfang an liegt im Menschen die Sucht, gut dazustehen. In der Erzählung des Sündenfalls wird das äußerst illustrativ beschrieben: Es ist die Erzählung von der großen Ausrede. Adam schob die Schuld auf Eva: Die Frau, die du mir beigesellt hast, die war es! Eva schob die Schuld auf die Schlange. Und es sind immer die anderen schuld. Die Folge der Ursünde ist der Hochmut, seine Fehler nicht eingestehen zu wollen. Das Abschieben von Negativem auf andere ist heute zu einer umfassenden gesellschaftlichen Mentalität geworden. Die Frankfurter Schule in den 60er-Jahren propagierte die Kritikfähigkeit als höchstes Ideal des selbstbefreiten Menschen. Damit geht eine tragische Charakterverformung einher, die Jesus mit den Worten entlarvt hat: Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, das Brett aber vor deinem eigenen Kopf bemerkst du nicht (vgl. Mt 7,3). Das eigene Ich stilisiert sich in dem Maß zur obersten Bewertungsinstanz der anderen hoch, wie es zugleich unfähig wird, sich selbst realistisch einzuschätzen. Das Ego wird nicht nur blind gegenüber sich selbst, es setzt sich auf den Thron der Selbstgefälligkeit und wartet auf seine Anbeter. Doch alle anderen sitzen ebenfalls auf ihren Thronen, sodass niemand da ist, der dieses Ich anzubeten bereit wäre. In Ermangelung fremder Wertschätzung bleibt dem egozentrischen Menschen nichts anderes übrig als einen Minderwertigkeitskomplex zu entwickeln. Merkwürdig: man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die Menschen, die keine eigenen Fehler mehr kennen, glücklich und zufrieden wären. Es sind ja doch immer nur die anderen schuld. Das eigene Ich müsste dabei doch eigentlich fein herauskommen. Aber nein, die Menschen sind unzufriedener und neurotischer als je zuvor. Warum? Weil hier ein zerstörerischer Mechanismus waltet! Johannes hatte diese Dämonie beim Namen genannt. Er sprach von Lüge und Selbstbetrug: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns (1 Joh 1,8). So gerät der kritisch-gewordene Egozentriker in Nöte und Lebensängste. Und gerade hier schließt sich der Circulus vitiosus, der Kreislauf der Perversion: Denn gerade hier raten manche Psychotherapeuten dem über die Welt und sich selbst frustrierten Menschen nichts anderes, als dass er sich in seinen Beklemmungen und Minderwertigkeitsgefühlen immer nur suggerieren solle: Ich bin gut, ich kann alles, ich bin stark, ich bewältige alles, ich bin der Beste usw.! Eine fatale Therapie, denn keine vordergründige Suggestion kann die hintergründige Last der Sünde und der Unordnung jemals heilen. So wird man nicht frei, sondern der über die Welt Frustrierte gerät immer tiefer in die Gefangenschaft des eigenen Ichs. Er wird immer trauriger und verzagter. Doch es gibt Heilung. Bruder Ephraim, der Gründer der lebendigen Gemeinschaft der Seligpreisungen, trifft den Punkt, wenn er formuliert: Das Problem ist, dass der Mensch sein eigenes Herz nicht kennt. Oder vielmehr, dass er dunkle Bereiche vor sich selbst verbirgt, die seine Seele verwüsten, die er aber als verborgene Schuld beibehält. Man könnte das alte Sprichwort zitieren: Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Die ehrliche Selbsterkenntnis, das Annehmen der eigenen Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit ist eine große Gnade!
Für Bestellungen aus Österreich und Deutschland: [email protected] Für Bestellungen aus der Schweiz: Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuPhilosophie
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
