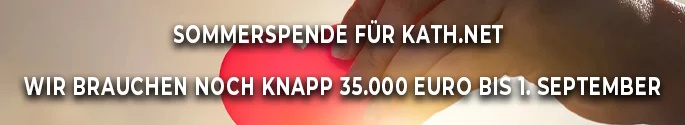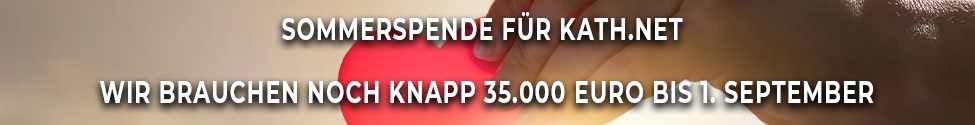 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Das wirklich Neue und das leere Grab17. März 2011 in Aktuelles, keine Lesermeinung Die Auferstehung ist kein der Vergangenheit zugehörendes Einzelereignis, sondern ein Mutationssprung schlechthin, der hinführt zur Gegenwart des Herrn im Heute. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Nur wenn Jesus auferstanden ist, ist wirklich Neues geschehen, das die Welt und die Situation des Menschen verändert. Dann wird er der Maßstab, auf den wir uns verlassen können. Denn dann hat Gott sich wirklich gezeigt. Insofern ist bei unserer Suche nach der Gestalt Jesu die Auferstehung der entscheidende Punkt. Ob Jesus nur war oder ob er auch ist das hängt an der Auferstehung. Im Ja oder Nein dazu geht es nicht um ein einzelnes Ereignis neben anderen, sondern um die Gestalt Jesu als solche (Jesus von Nazareth II, S. 266). Mit diesen Worten umschreibt Papst Benedikt XVI. den Kern des Christentums, die radikale Neuheit, die sich durch Sieg Christi über den Tod vollzieht und im leeren Grab sichtbar und spürbar wird. Die Auferstehung ist somit kein Bild für einen geistlichen Vollzug, sondern das Wirklichste vom Wirklichen, insofern Gott durch sie die neue, die ganz andere Wirklichkeit der siegreichen Liebe endgültig für das Heil der Menschen stiftet. Aus diesem Grund ist die Auferstehung Jesu nicht ein Einzelereignis, das wir auf sich beruhen lassen könnten und das nur der Vergangenheit zugehörte, sondern ein Mutationssprung, so der Papst, der sich nicht scheut, ein missverständliches Wort als Analogie zu benutzen (vgl. S. 268). Die Auferstehung ist der Vollzug der Gründung, der aus den Auferstehungsberichteten mehr macht als verkleidete liturgische Szenen, so Joseph Ratzinger in seiner Einführung in das Christentum (München 1968, S. 263): Sie bezeugen ein Zukommnis, das nicht aus dem Herzen der Jünger aufstieg, sondern von außen an sie herantrat und gegen ihren Zweifel sie übermächtigte und sie gewiss werden ließ: Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Der im Grabe lag, ist nicht mehr dort, sondern er wirklich er selber lebt. Er, der in die andere Welt Gottes hineinverwandelt war, zeigte sich doch mächtig genug, um bis zur Handgreiflichkeit hin klarzumachen, dass er selbst ihnen wieder gegenüberstand, dass in ihm die Macht der Liebe wirklich sich stärker erwiesen hatte als die Macht des Todes (ebd.). Die der Biologie entlehnte Analogie des Mutationssprunges vom Bereich des Wollens hin zur wahren neuen Wirklichkeit führt zur Klärung des Sinnes und Umfanges des neuen Gebots der Liebe. Bereits 1968 erklärte Ratzinger das Ereignis der Auferstehung in der Dimension, die das endliche Sein zu seiner endültigen Vervollkommung führt: Nur wo für jemanden der Wert der Liebe über dem Wert des Lebens steht, das heißt, nur wo jemand bereit ist, das Leben zurückzustellen hinter der Liebe und um der Liebe willen, nur da kann sie auch stärker und mehr sein als der Tod. Damit sie mehr werden kann als der Tod, muss sie zuerst mehr sein als das bloße Leben. Wo sie das aber dann nicht bloß dem Wollen, sondern der Wirklichkeit nach zu sein vermöchte, da würde das zugleich heißen, dass die Macht der Liebe sich über die bloße Macht des Biologischen erhoben und sie in ihren Dienst genommen hätte. In der Terminologie von Teilhard de Chardin gesprochen: Wo das stattfände, da wäre die entscheidende Komplexität und Komplexion geschehen; da wäre auch der Bios umgriffen und einbegriffen von der Macht der Liebe. Da würde sie seine Grenze den Tod überschreiten und Einheit schaffen, wo er trennt. Wenn die Kraft der Liebe zum andern irgendwo so stark wäre, dass sie nicht nur dessen Gedächtnis, den Schatten seines Ich, sondern ihn selbst lebendig zu halten vermöchte, dann wäre eine neue Stufe des Lebens erreicht, die den Raum der biologischen Evolutionen und Mutationen hinter sich ließe und den Sprung auf eine ganz andere Ebene bedeuten würde, in der Liebe nicht mehr unter dem Bios stünde, sondern sich seiner bediente. Eine solche letzte Mutations- und Evolutionsstufe wäre dann selbst keine biologische Stufe mehr, sondern würde den Ausbruch aus der Alleinherrschaft des Bios bedeuten, die zugleich Todesherrschaft ist; sie würde jenen Raum eröffnen, den die griechische Bibel zoe nennt, das heißt endgültiges Leben, welches das Regiment des Todes hinter sich gelassen hat. Die letzte Stufe der Evolution, deren die Welt bedarf, um an ihr Ziel zu kommen, würde dann nicht mehr innerhalb des Biologischen geleistet, sondern vom Geist, von der Freiheit, von der Liebe. Sie wäre nicht mehr Evolution, sondern Entscheidung und Geschenk in einem (ebd., S. 257f). Daher versteht es sich von da aus von selber, dass das Leben des Auferstandenen nicht wieder Bios, die bio-logische Form unseres innergeschichtlichen Todeslebens ist, sondern zoe, neues, anderes, endgültiges Leben; Leben, das den Todesraum der Bios-Geschichte überschritten hat, der hier durch eine größere Macht überstiegen worden ist (ebd. S. 260). Die Auferstehung Christi ist der Grund der Verkündigung und des Glaubens. In ihr spricht der Urgrund von allem: die Gemeinschaft mit Gott, aus der sich die Verstehbarkeit von Welt und Mensch ergibt und ohne die alles in das Dunkel der Sinnlosigkeit versinkt. Durch die Auferstehung wird Christus heute gegenwärtig, so der Papst. In Jesu Auferstehung ist eine neue Möglichkeit des Menschseins erreicht, die alle angeht und Zukunft, eine neue Art von Zukunft, für die Menschen eröffnet (Jesus von Nazareth II, S. 268). Dem modernen Menschen und dem aufgeklärten Denken scheinen die Berichte über die Auferstehung fern, so der Papst. Es schient evident, dass infolge der Umwälzung des naturwissenschaftlichen Weltbildes die traditionellen Vorstellungen von der Auferstehung Jesu als erledigt zu betrachten. Das, worum es geht, fällt nicht in den Raum der wissenschaftlichen Gegebenheiten, denn: das Bestehende wird nicht bestritten. Es wird uns vielmehr gesagt: Es gibt eine Dimension mehr, als wir sie bisher kennen (ebd. S. 271). Diese Dimension eröffnet sich mit dem leeren Grab. Zusammenfassend erläutert Benedikt XVI. die geschichtliche Bedeutung der Auferstehung mit drei Unterscheidungen: Jesus ist kein ins allgemein biologische Leben Zurückgekehrter, der dann nach den Gesetzen der Biologie eines Tages wieder sterben müsste. Dann ist kein Gespenst (Geist). Das bedeutet: Er ist nicht jemand, der eigentlich der Totenwelt zugehört, aber irgendwie sich in der Lebenswelt zeigen kann. Drittens: die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind aber auch etwas anderes als mystische Erfahrungen, in denen der menschliche Geist einen Augenblick über sich hinausgehoben wird und die Welt des Göttlichen und Ewigen wahrnimmt, um dann wieder in den normalen Horizont seines Daseins zurückzukehren. Die mystische Erfahrung ist eine zeitweilige Entgrenzung des Raums der Seele und ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Sie ist aber nicht eine Begegnung mit einer von außen auf mich zutretenden Person (Jesus von Nazareth II, S. 298). Die Auferstehung ist ein Ereignis in der Geschichte, das den Raum der Geschichte sprengt und über sie hinausreicht, wobei die Materie selbst in eine neue Wirklichkeitsweise umgebrochen wird (vgl. S. 299): In der Tat ist die apostolische Predigt mit ihrer Leidenschaft und ihrer Kühnheit undenkbar ohne eine wirkliche, von außen die Zeugen treffende Berührung mit dem ganz Neuen und Unerwarteten, das im Sich-Zeigen und Sprechen des auferstandenen Christus bestand. Nur ein wirkliches Ereignis von radikal neuer Qualität konnte die apostolische Predigt ermöglichen, die nicht mit Spekulationen oder inneren, mystischen Erfahrungen zu erklären ist. Sie lebt in ihrer Kühnheit und Neuheit von der Wucht eines Geschehens, das niemand erdacht hatte und das alle Vorstellungen sprengte (ebd. S. 301). Der älteste Bericht über das leere Grab ist der des Markusevangeliums (Mk 16). Drei Frauen machten sich frühmorgens bei Sonnenaufgang auf, um den Leichnam Jesu zu salben. Verstört, wie sie von den tragischen Ereignissen waren, hatten sie nicht einmal daran gedacht, wer ihnen denn nun den Stein vor der Grabhöhle wegwälzen soll. Maria von Magdala war sogar so erschüttert, dass sie den Auferstandenen dann vor dem Grab nicht erkannte und ihn für einen Gärtner hielt (Joh 20,15). Der Schriftsteller Gilbert K. Chesterton beschreibt dies so am Ende des Kapitels The Strangest Story in the World (Die merkwürdigste Geschichte in der Welt) in seinem Werk The Everlasting Man (Der Ewige Mensch): Am dritten Tag kamen die Freundinnen Christi bei Tagesanbruch zu jenem Ort; dort fanden sie das Grab leer und den Stein weggerollt. In verschiedener Weise begriffen sie das neue Wunder; doch sogar für sie war es schwer zu begreifen, dass die Welt in der Nacht gestorben war. Was sie sahen, war der erste Tag einer neuen Schöpfung, mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde; und in der Gestalt eines Gärtners ging Gott wieder durch den Garten, in der Kühle nicht des Abends, sondern der Morgendämmerung. Nach dem Sündenfall, dem Beginn der Nacht der Menschheit, als Gott im Paradiesgarten einher schritt, neigte sich der Tag zu seinem Ende (vgl. Gen 3,8), der Mensch versteckte sich unter den Bäumen. Jetzt ist der Erstgeborene von den Toten der Gärtner der neuen Schöpfung. Der erlöste Mensch trifft ihn am Morgen des neuen Tages. Die Geschichte der Menschheit hat sich in Christus vollendet: das Grab ist leer. Der am Kreuz gestorbene und auferstandene Christus ist heute bei den Menschen. Dass der Gottessohn gekommen ist, ist die Voraussetzung dafür, dass er im Heute durch das Zeugnis seiner Verkündigung erwartet werden kann: in seiner wahren Gegenwart. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuBenedikt XVI.
| 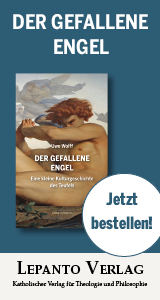      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||