 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||||||||||
              
| ||||||||||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Der Tisch, der nie verlassen wird. Die Wahrheit des liebenden Gottes angesichts des Verrats13. August 2025 in Aktuelles, 1 Lesermeinung Papst Leo XIV. über die Liebe und die Wahrheit eines liebenden Gottes angesichts des Verrats. Jesu Treue endet nicht am Abend des Verrats. Der Schrei des Jüngers. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) „Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre“ (Mk 14,17-21). Die hohen Temperaturen in Rom veranlassten den Vatikan dazu, die Generalaudienz von Papst Leo XIV. an diesem Mittwoch in die Aula Paul VI zu verlagern. Anschließend ging der Papst dann in den Petersdom, um jene Pilger zu begrüßen, die keinen Platz mehr in der Aula gefunden hatten und die Audienz über Bildschirme mitverfolgten. In seiner Katechese setzte der Papst den Zyklus in der Schule des Evangeliums fort und nahm die Gläubigen mit „auf unserem Weg in der Schule des Evangeliums, den Schritten Jesu folgend in den letzten Tagen seines Lebens“. Im Mittelpunkt stand eine Szene, die Leo XIV. als „intim, dramatisch, aber zutiefst wahr“ bezeichnete: die Ankündigung Jesu beim letzten Abendmahl, dass einer der Zwölf ihn verraten werde: „In Wahrheit, ich sage euch: Einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten“ (Mk 14,18). „Starke Worte“, so der Papst, „die Jesus nicht ausspricht, um zu verurteilen, sondern um zu zeigen, dass die Liebe, wenn sie wahr ist, nicht ohne die Wahrheit auskommen kann“. Der Raum, in dem zuvor alles sorgfältig vorbereitet worden war, füllte sich plötzlich mit „einem stillen Schmerz, aus Fragen, Verdacht und Verwundbarkeit“. Dieser Schmerz sei auch uns vertraut: „wenn in den uns nächsten Beziehungen der Schatten des Verrats Einzug hält“. Doch Jesu Haltung überrasche: „Er erhebt nicht die Stimme, er zeigt nicht mit dem Finger, er nennt nicht den Namen des Judas. Er spricht so, dass jeder sich selbst fragen kann“. Diese Selbstbefragung der Jünger („Doch nicht etwa ich?“; vgl. Mk 14,19) ist für Leo XIV. „vielleicht eine der aufrichtigsten Fragen, die wir uns selbst stellen können“. Sie sei „nicht die Frage des Unschuldigen, sondern des Jüngers, der sich schwach weiß. Nicht der Schrei des Schuldigen, sondern das Flüstern dessen, der, obgleich er lieben will, weiß, dass er verletzen kann“. Hier beginne der Weg des Heils: „Jesus prangert nicht an, um zu demütigen. Er sagt die Wahrheit, weil er retten will“. Die Reaktion der Jünger sei nicht Wut, sondern Traurigkeit: „Es ist ein Schmerz, der aus der realen Möglichkeit erwächst, selbst beteiligt zu sein. Diese Traurigkeit, wenn sie aufrichtig angenommen wird, wird ein Ort der Umkehr“. Besonders ging der Papst auf das Wort Jesu ein: „Weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre“ (Mk 14,21). „Das ist keine Verluchung,“ betonte Leo XIV., „sondern ein Schrei des Schmerzes“. Das griechische „Wehe“ („οὐαί“) klinge „wie ein Seufzen, ein ‚Ach‘ voller Mitleid“. Gott urteile nicht nach menschlichem Muster: „Wir sind gewohnt zu richten. Gott hingegen nimmt das Leiden auf sich. Er rächt sich nicht, sondern er leidet“. Das Wort „es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre“ sei „nicht eine vorweggenommene Verdammung, sondern eine Wahrheit, die wir anerkennen können: Wenn wir die Liebe, die uns ins Dasein gerufen hat, verraten, verlieren wir den Sinn unseres Daseins“. Am dunkelsten Punkt menschlicher Untreue leuchte dennoch Hoffnung auf: „Gerade dort beginnt das Licht zu scheinen. Wenn wir unsere Grenze anerkennen und uns vom Schmerz Christi berühren lassen, können wir neu geboren werden“. Die Freundschaft Jesu kenne kein naives Idealbild: „Er weiß, dass keine Freundschaft vor dem Risiko des Verrats sicher ist. Aber er vertraut weiter, er bleibt am Tisch sitzen, er bricht das Brot auch für den, der ihn verraten wird“. Diese „stille Kraft Gottes“ verlasse „niemals den Tisch der Liebe, selbst wenn er weiß, dass er allein gelassen wird“. Am Ende richtete Leo XIV. die Frage an alle Gläubigen: „Sind vielleicht wir es? Nicht um uns angeklagt zu fühlen, sondern um der Wahrheit in unserem Herzen einen Raum zu öffnen“. Die Erlösung beginne mit dieser Einsicht – und mit der Gewissheit: „Auch wenn wir versagen, Gott bleibt treu. Auch wenn wir verraten, er hört nicht auf, uns zu lieben. Wenn wir uns von dieser Liebe erreichen lassen - einer Liebe, die demütig, verwundet, aber immer treu ist - , können wir neu leben: nicht mehr als Verräter, sondern als immer geliebte Kinder“. *** Die Katechese von Papst Leo XIV. steht in enger Kontinuität mit der patristischen Auslegung der Verratsszene im Abendmahlssaal. Besonders bei Augustinus und Chrysostomus wird betont, dass Christus den Verräter nicht entlarvt, um zu beschämen, sondern um zur Umkehr einzuladen. Augustinus (In Io. Ev. 62,5) interpretiert das „Wehe“ nicht gleichsam als richterliche Verdammung, sondern als Ausdruck tiefen göttlichen Mitleids mit dem, der sich selbst vom Leben trennt. Das Motiv der Frage „Bin ich es etwa?“ findet bei den Vätern eine doppelte Deutung: Einerseits als Ausdruck demütiger Selbsterkenntnis, andererseits als Anstoß, das eigene Herz zu prüfen (vgl. Origenes). Die vom Papst hervorgehobene Traurigkeit der Jünger entspricht der „salutaris tristitia“ (2 Kor 7,10), die die Väter als göttliche Heiltrauer beschreiben. Die beständige Treue Christi, der am Tisch bleibt und das Brot bricht - auch für den Verräter -, verweist auf die patristische Theologie der „synkatabasis“, des göttlichen Herabstiegs in die menschliche Schwachheit. Für Gregor den Großen ist gerade diese Treue der Prüfstein wahrer Hirtenliebe (Regula Pastoralis II,6). So verknüpfte Leo XIV. den biblischen Bericht mit dem urkirchlichen Verständnis: Wahrheit ohne Liebe ist keine christliche Wahrheit, und Liebe ohne Wahrheit wird zur Lüge. Die Pilger und Besucher aus dem deutschen Sprachraum grüßte der Heilige Vater mit den folgenden Worten: Liebe Pilger deutscher Sprache, am kommenden Freitag feiern wir das Hochfest der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den Himmel. Vertrauen wir uns ihrer Führung an, damit wir ihrem Beispiel vollkommener Treue zum Herrn folgen und so zur himmlischen Herrlichkeit gelangen können. Du getreue Jungfrau, bitte für uns!
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal! 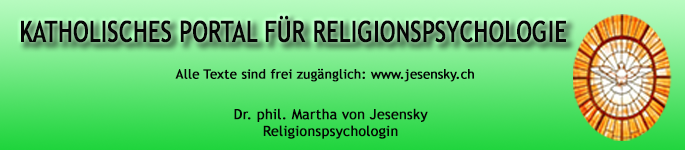 Lesermeinungen
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 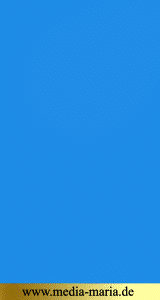      Top-15meist-gelesen
| |||||||||||
 | ||||||||||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||

