 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Auschwitz und die Päpste: Glaubenszweifel und Vergebungsbitten18. Jänner 2020 in Chronik, 3 Lesermeinungen Auschwitz, wo der Glaube an Gott der bisher wohl härtesten Probe unterzogen wurde, war und ist auch für das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Herausforderung - Kathpress-Hintergrundbericht von Roland Juchem. Vatikanstadt (kath.net/ KAP) Dieser Bericht der "Jewish Agency for Palestine" erwähnte unter anderem, dass die Bewohner des Warschauer Ghettos umgebracht würden. Von Exekutionen in einem KZ war die Rede und dass Juden aus Westeuropa "ins Schlachthaus geschickt" würden. Ob der Vatikan Näheres dazu wisse, wollte Taylor wissen. Der Papst und seine Mitarbeiter waren damals nicht die einzigen, die mit zunächst unbestätigten und teils widersprüchlichen Berichten über Nazi-Gräuel konfrontiert wurden. Auch in Washington wurden solche und ähnliche Berichte 1942 und noch 1943 zunächst für Gerüchte gehalten. Doch nach und nach verfestigte sich die Gewissheit. Am 14. September 1942 etwa drängte die britische Regierung: "Seine Heiligkeit, der Papst, sollte sorgfältig prüfen, wie zweckmäßig eine öffentliche und spezifische Verurteilung der Behandlung der Bevölkerung in den von Deutschen besetzten Gebieten durch die Nazis ist". Eine Woche später berichtete Taylor, der sich in Rom aufhielt, dem Papst über die Deportation von Juden aus dem besetzten Frankreich. Bei einer anschließenden Begegnung mit dem für die Außenbeziehungen des Heiligen Stuhls zuständigen Mitarbeiter Domenico Tardini, bei der es auch schon um die Neuordnung Europas nach dem Krieg hing, sprach Taylor über "die Gelegenheit und Notwendigkeit" eines Papst-Wortes gegen die "vielen Vergehen, die von Deutschen begangen werden". Auf den Einwand, der Papst habe sich bereits mehrfach gegen jegliche Verbrechen geäußert, entgegnete Taylor: "Er kann das wiederholen." Worauf Tardini notierte: "Mir blieb nichts, als zuzustimmen." Wissenschaftliche Erforschung beginnt Dies sind nur einige der bisher bekannten Belege, wann und wie man im Vatikan von der Juden-Verfolgung erfuhr. Zu finden sind sie in zwölf Bänden mit einer ersten, groben Auswahl von Archiv-Material aus dem Pontifikat Pius' XII. (1939-1958). Papst Paul VI. (1963-78) hatte es ab 1965 zusammentragen lassen. Mit der Öffnung des inzwischen geordneten vatikanischen Archivmaterials zu Pius XII. ab dem 1. März soll eine umfassende wissenschaftliche Erforschung beginnen - auch zum Thema Pius XII. und der Holocaust. Für ein genaueres Bild zur Frage, ob Pius XII. und andere im Vatikan zu wenig gesagt und getan haben und warum das so war, wird die Wissenschaft noch Jahre brauchen. Außerdem: Warum blieben auch nach 1945 päpstliche Äußerungen zunächst rar? Schon als Delegat in Bulgarien hatte Angelo Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIII. (1958-1963), während des Zweiten Weltkrieges die Judenverfolgung mitbekommen. Der Holocaust war sicherlich einer der Gründe, warum er beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) eine eigene Erklärung zum Judentum durchsetzen wollte. In der Erklärung "Nostra aetate" zu den nichtchristlichen Religionen "beklagt die Kirche" auch "alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben". Modernes Golgotha Johannes Paul II. (1978-2005), der als Pole ebenfalls Opfer der deutschen Besatzung war und enge jüdische Freunde hatte, war der erste Papst, der das frühere Vernichtungslager Auschwitz besuchte. Schon als Priester und Bischof war er mehrfach dort gewesen. Viele Male "bin ich hinabgestiegen in die Todeszelle von Maximilian Kolbe, habe vor der Erschießungswand gekniet und bin durch die Ruinen der Verbrennungsöfen gegangen", sagte der Papst am 7. Juni 1979 bei einer Messe in Auschwitz-Birkenau. Jetzt kniet er wieder an "diesem Golgotha der modernen Welt". Wenn jedoch "der Schrei der Menschen, die hier gefoltert wurden", Frucht bringen solle für Europa und die Welt, so Johannes Paul II. weiter, "dann muss die Erklärung der Menschenrechte ihre daraus gezogenen angemessenen Folgen haben". Anfang der 1990er Jahre sorgte ein Kloster von Karmelitinnen direkt am Rand des Vernichtungslagers Birkenau für Kontroversen zwischen katholischen Polen und Juden in aller Welt. Allein der aus Polen stammende Papst konnte damals die Wogen einigermaßen glätten und den Umzug der Schwestern anordnen. Der deutsche Papst Im Mai 2006 kam Papst Benedikt XVI. (2005-2013) nach Auschwitz. "Ich stehe hier als Sohn des deutschen Volkes", sagte er und erinnerte an seinen polnischen Vorgänger. "Ich konnte unmöglich nicht hierherkommen" an diesen Ort einer "Anhäufung von Verbrechen gegen Gott und den Menschen ohne Parallele in der Geschichte". Dies sei "eine Pflicht der Wahrheit, dem Recht derer gegenüber, die gelitten haben". Insgesamt wurde auch seine Rede als Beitrag zur Erinnerung und Versöhnung aufgenommen. Dennoch wurde Benedikts Anmerkung, dass eine "Schar von Verbrechern" das Volk der Deutschen "zum Instrument ihrer Wut des Zerstörens und des Herrschens gebraucht und missbraucht" habe, von einigen als unziemliche Verharmlosung aufgefasst. Begonnen hatte Benedikt XVI. mit der Feststellung: "An diesem Ort versagen die Worte, kann eigentlich nur erschüttertes Schweigen stehen - Schweigen, das ein inwendiges Schreien zu Gott ist: Warum hast du geschwiegen?" Stiller Besuch von Franziskus Diese Aussage griff sein aus Argentinien stammender Nachfolger auf. Als Papst Franziskus im Juli 2016 die Gedenkstätte Auschwitz besuchte, hielt er keine Rede. Still und allein saß der Papst vor der Erschießungswand, in der Hungerzelle und betete. Allein im Gedenkbuch hinterließ er die Bitten: "Herr, erbarme dich deines Volkes! Herr, vergib so viel Grausamkeit!" Copyright 2020 Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, Österreich (www.kathpress.at) Alle Rechte vorbehalten Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuNazi-Zeit
| 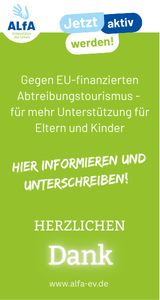       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
