 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Elias Zoghbi und die Einheit der Kirche9. August 2025 in Weltkirche, 1 Lesermeinung "Der melkitische Erzbischof Elias Zoghbi war eine prophetische Gestalt des 20. Jahrhunderts. Er sprach nicht nur über Einheit – er lebte sie." Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer Eichstätt (kath.net) Elias Zoghby, melkitischer Erzbischof von Baalbek (1912–2008) wurde am 9. Januar 1912 in Kairo geboren und starb am 16. Januar 2008. Er war von 1968 bis zu seinem Rücktritt 1988 Erzbischof von Baalbek der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche im Libanon. Er gilt als eine der profiliertesten Persönlichkeiten der ökumenischen Bewegung des 20. Jahrhunderts im Nahen Osten und in den U.S.A.. Sein theologisches Denken kreiste um die Versöhnung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Mit spiritueller Tiefe, dogmatischer Weitsicht und einem festen Stand in der kirchlichen Tradition entwarf Zoghbi eine Vision der Einheit, die bis heute Orientierung geben kann – nicht als Strategie, sondern als geistlicher Weg. Der vorliegende Beitrag entfaltet seine Sicht in drei Dimensionen: Communio, Eucharistie und das Papstamt. Diese sogenannte Zoghbi-Initiative, von der melkitischen Synode mit 24 zu 2 Stimmen angenommen, schlug theologisch vor, eine doppelte Kirchengemeinschaft zu verwirklichen: Eucharistische Communio sowohl mit Rom als auch mit der griechisch-orthodoxen Kirche von Antiochien – gegründet auf dem Glaubensbestand des ersten Jahrtausends. Zoghbi war überzeugt: Kirchliche Einheit kann nur auf versöhnter Verschiedenheit beruhen – nicht auf Uniformität, nicht auf Rückkehrlogik, sondern auf gegenseitiger Anerkennung. 1. Theologische Substanz: Glaubensgemeinschaft im Licht der Väter 2. Ziel: Communio beiderseits – nicht alternativ 3. Reaktionen: Zustimmung, Skepsis, Zurückhaltung 4. Wirkung: Ein Katalysator von bleibender Bedeutung II. Einheit in geistlicher Tiefe: Kirche als Communio Für Zoghbi war die Kirchenspaltung kein bloß strukturelles Problem, sondern ein geistlicher Bruch. In „The Desire for Christian Unity“, ein Aufsatz von ihm, (in: Anthologie The Eastern Churches and Catholic Unity, hg. von Herder/Palm Publishers, Montreal, 1963, 91–98) beschreibt er die Trennung der Christenheit als Folge der inneren Zerrissenheit des Menschen: „Ein geteiltes Herz kann keine Gemeinschaft schaffen.“ Diese Sicht steht tief in der Tradition östlicher Theologie. Einheit ist Frucht der Heiligung – nicht Ergebnis von Strategie. Wer mit Christus geeint ist, wird auch mit dem Bruder eins sein. 1. Eucharistie als Quelle und Ziel der Einheit 2. Sakramentale Realität und Communio-Struktur 3. Einheit als Ziel – nicht als Mittel III. Primat, Dogmenentwicklung und das Amt zur Einheit Das dritte, wohl sensibelste Feld betraf für Zoghbi das Verständnis des Papstamts. Er stellte sich nicht gegen den römischen Primat – im Gegenteil: Er verstand ihn als Dienst an der Communio. Doch dieser Dienst müsse geistlich neu interpretiert werden – im Licht der Väter und des ersten Jahrtausends. 1. Der Primat als Dienst – nicht als Herrschaft 2. Der Kanon 34 der apostolischen Kanones (Canon Apostolorum, einer Sammlung von Kirchenordnungen aus dem 4. Jh.) bildet für Zoghbi das Modell kirchlicher Leitung: „Die Bischöfe jeder Nation sollen denjenigen anerkennen, der unter ihnen Erster ist, und ihn als ihr Haupt ansehen; und sie sollen nichts Wichtiges ohne seine Zustimmung tun; sondern jeder tue nur das, was seine eigene Diözese betrifft, und das nur mit seinem Mitwirken. Aber auch der Erste soll nichts ohne das Einverständnis aller tun. Denn so wird Einmütigkeit herrschen, und Gott wird durch den Herrn in Heiligem Geist verherrlicht.“. 3. Dogmenentwicklung: Rezeption statt Rücknahme Er forderte eine theologische Rezeption, die die unterschiedlichen Zugänge des Ostens respektiert. Wahrheit bleibt Wahrheit, aber sie kann kulturell und liturgisch verschieden formuliert sein. 4. Der Papst als Zeichen der Einheit IV. Hoffnung auf Einheit: Papst Leo XIV. im Geiste Elias Zoghbis Mit der Wahl von Papst Leo XIV. scheint, dass ein neues Kapitel im ökumenischen Dialog zwischen Ost und West aufgeschlagen wurde. Viele Beobachter erkennen in ihm eine theologische und geistliche Kontinuität zu den Anliegen, die Erzbischof Elias Zoghbi über Jahrzehnte hinweg mit innerer Leidenschaft vertreten hat. Auch wenn sich Kontexte und Stil unterscheiden, ist es vor allem die gemeinsame Vision einer Kirche als Communio, als vom Geist geeinte Vielheit, die beide verbindet. Leo XIV. steht theologisch in der augustinischen Tradition. Sein Wahlspruch „In Illo uno unum“ („In jenem Einen eins“) bringt jene tiefe Einsicht zum Ausdruck, die auch Zoghbi leitete: Einheit ist kein Projekt menschlicher Anstrengung, sondern Geschenk Gottes, das in Christus grundgelegt ist und in der Eucharistie sakramental Gestalt annimmt. Die Vision einer Kirche, die nicht durch Uniformität, sondern durch geistliche Harmonie geeint ist, lebt in seinem Denken auf neue Weise weiter. Besonders in seiner Haltung gegenüber den Ostkirchen wird diese Kontinuität sichtbar. Leo XIV. begegnet ihnen mit ehrlichem Respekt für ihre synodalen Strukturen, ihre liturgische Tiefe und ihre mystische Theologie. Die von ihm angestrebte Einheit basiert nicht auf rechtlichen Forderungen, sondern auf einem geistlichen Miteinander, das aus der gemeinsamen dogmatischen Basis des ersten Jahrtausends schöpft – ein Gedanke, der direkt aus Zoghbis Doppel-Communio-Initiative erwachsen sein könnte. Die anstehende 1700-Jahrfeier des Konzils von Nizäa begreift Leo XIV. nicht nur als historisches Gedenken, sondern als Kairos für die Erneuerung der Communio zwischen den Kirchen. Die Einladung zu gemeinsamem Gebet, theologischer Reflexion und liturgischer Mitfeier zeigt, dass hier kein Rückfall in konfessionelles Denken droht, sondern eine geistliche Tiefenökumene des gemeinsamen Miteinanders nach vorne angestrebt wird. Auch das Petrusamt interpretiert Leo XIV. in einer Weise, die Zoghbi gefallen hätte: nicht als richterliche Macht, sondern als Dienst der Einheit, getragen von Liebe, Hören und Demut. Seine synodale Grundhaltung, seine ekklesiologische Sensibilität und sein Vertrauen in die heilende Kraft des Geistes machen Hoffnung: Dass das, was Zoghbi als Vision begann, unter Leo XIV. kirchlich weiter reifen darf. Papst Leo XIV. hat nicht nur einen neuen Ton angeschlagen – er gibt der alten Wahrheit neue Stimme. In seinem Pontifikat könnte sich erfüllen, was Zoghbi erhofft und Papst Johannes Paus II. ausgesprochen hat: Dass die Kirche wieder atmet mit beiden Lungenflügeln – östlich und westlich. Und dass das Petrusamt wirklich das wird, was es sein soll: ein Ort geistlicher Autorität in Liebe, ein Band der Communio, ein Dienst der Einheit der Kirchen.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu | 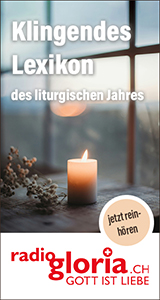      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
