 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
| 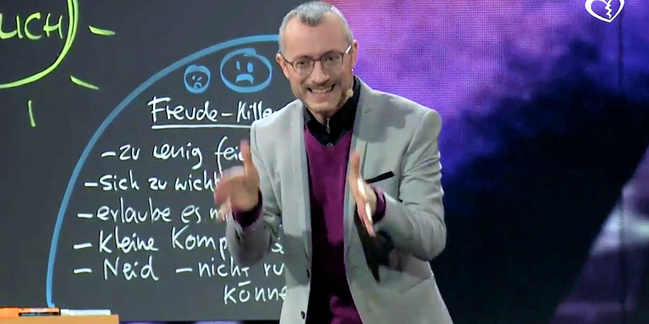 Das Kreuz im öffentlichen Raum3. Mai 2018 in Kommentar, 13 Lesermeinungen Dass gerade Vertreter der Kirche Politiker für den Vorschlag kritisieren, das Kreuz in öffentlichen Amtsgebäuden aufzuhängen, ist erstaunlich. Gastkommentar von Johannes Hartl Augsburg (kath.net/Blog Johannes Hartl) Das Kreuz in öffentlichen Gebäuden? Auf jeden Fall, meine ich. Söder hat mit seinem Vorstoß eine Debatte eröffnet, die zentral ist. Dass gerade Vertreter der Kirche Politiker für den Vorschlag kritisieren, das Kreuz in öffentlichen Amtsgebäuden aufzuhängen, ist erstaunlich. Ich glaube, dass der Vorschlag richtig ist und weder dem Wesen des Christentums widerspricht noch der weltanschaulichen Neutralität des Staates. Zunächst zu dem Vorwurf, Söder betreibe nur Wahlkampf. Söder ist ein Politiker und jeder Politiker betreibt immer Wahlkampf. Wie es um die tiefsten Herzensmotive eines Politikers bestellt ist, wage ich nicht zu bewerten. Doch ob Windkraft, Krippenplatz oder Mindestlohn: man kann jedem politischen Handeln vorwerfen, es sei nur wahlkampfstrategischen Überlegungen geschuldet. Das mag sein, sagt aber über die Sinnhaftigkeit des Vorschlags nichts aus. Politisches Handeln ist im demokratischen Staat immer auch das Buhlen um Mehrheiten, so ist das nun mal. Dass Söder durch seinen Vorschlag Religion politisiere, ist ein Vorwurf der sich auf jedes einzelne Mal anwenden ließe, wo immer ein Politiker auf Religion Bezug nimmt. Möchte man das vermeiden, schafft man ein Klima, in dem Glaube grundsätzlich im politischen Diskurs nicht mehr vorkommen dürfte. Und das käme einer Verbannung des Religiösen aus der Öffentlichkeit gleich. Denn Politik bezieht sich in ihrem Handeln auf das Gesamt der Gesellschaft, nicht nur auf einen irgendwie abgesteckten politischen Bereich. Wenn ein Politiker deshalb auf die Bedeutung eines religiösen Symbols im Öffentlichen hinweist, dann hat das grundsätzlich nichts Unberechtigtes. (Mit etwas mehr Berechtigung könnte man augenzwinkernd fragen, ob es tatsächlich Aufgabe christlicher Amtsträger ist, sich zu jedwedem politischen Thema öffentlich zu positionieren, doch das nur nebenbei. Fest steht jedenfalls: die beiden Bereiche sind getrennt, doch keineswegs frei von Überschneidungen.) So zielt auch die Behauptung ins Leere, hier werde ein religiöses Symbol politisch missbraucht. Das Kreuz hat als religiöses Symbol unsere Gesellschaft maßgeblich mitgestaltet. Indem Politik dies anerkennt, drückt nicht Politik dem Glauben etwas ihm Fremdes auf, sondern weigert sich, einem Gesellschaftsmodell zuzustimmen, in dem Glauben nur noch die Schattenexistenz im Elfenbeinturm zukommt. Das Kreuz in öffentlichen Dienstgebäuden aufzuhängen macht aus zwei Gründen Sinn. Der erste ist ein historischer, der zweite ein philosophischer. 1) Politik erfindet nicht die Gesellschaft, sondern gestaltet ihr Miteinander. Dieses fußt auf kulturelle und religiöse Grundlagen. Wo Politik diese durch neue zu ersetzen sucht, ist sie Ideologie geworden. Sie überschreitet ihren Auftrag. Der Respekt vor dem Gewachsenen und Vorhandenen ist das Korrektiv, das die herrschende politische und ideologische Szene davor bewahrt, totalitär zu werden. Nicht die CSU des 21. Jahrhunderts kommt auf die Idee, Kreuze in öffentlichen Räumen aufzuhängen. Die Frage ist eher, wer auf die Idee kommt, sie abzuhängen. Denn ob auf Berggipfeln, an Feldwegen, auf Gebäuden: in Europa prägt das Kreuz seit vielen Jahrhunderten das öffentliche Erscheinungsbild. Wie genau käme man auf die Idee, dass politische Räume sich im Sinne eines religiösen Vakuums darstellen müssten, das sich in europäischen Städten sonst nirgends findet? Man wird Mühe haben, eine europäische Innenstadt zu finden, die nicht von einem Kirchturm dominiert wird. Das kann einem gefallen oder auch nicht: so sieht Europa nunmal aus. Weshalb es Aufgabe der Politik sein sollte, eine religiös ungeprägte Öffentlichkeit zu inszenieren, erschließt sich mir nicht. Wie nun verhält sich aber diese Tatsache zur Religionsfreiheit und zur weltanschaulichen Neutralität des Staates? Diese ist nach deutschem (und erst recht nach bayerischem) Verständnis eben gerade kein radikaler Säkularismus wie in Frankreich. Er beschreibt das positive Recht jedes Menschen, seine Religion (oder seine Religionslosigkeit) offen und frei zu wählen und auszuüben. Ein Recht jedoch, im öffentlichen Leben von Religion nichts zu sehen und zu hören, gibt es nicht. Der Staat hat nicht die Aufgabe, Menschen religiös zu prägen. Er hat aber eben auch nicht die Aufgabe, Menschen areligiös zu prägen. Sondern er gestaltet das historisch Gewachsene. Nun geht es beim Kreuz aber nicht um ein beliebiges religiöses Symbol. Sondern es geht um ein Symbol der radikalen Liebe. Es geht um die Liebe dessen, der auch gesagt hat, man solle dem Kaiser geben, was dem Kaiser und Gott das was Gott gehört. Das Kreuz als Zeichen der Feindesliebe und der Gewaltlosigkeit ist das Gegenteil von Intoleranz, von religiöser Vereinnahmung. Indem heutige Demokratien sich nicht vor der Tatsache scheuen, dass sie in christlichen Ländern entstanden sind, betonen sie: nicht jede beliebige Weltanschauung ermöglicht die Freiheit des Menschen in gleichem Maße. Da das historisch wahr ist, trägt das Aufhängen von Kreuzen in öffentlichen Räumen zur Bewusstseinsbildung bei, dass der moderne Staat und seine Religions- und Meinungsfreiheit nicht im luftleeren Raum entstanden ist, sondern auf tiefe Weise auf die Feindesliebe dessen fußt, der da am Kreuz hängt. 2) Mit seiner Aussage, der freiheitlich-demokratische Staat stütze sich auf Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann, blieb der Bundesverfassungsrichter Böckenförde dauerhaft in Erinnerung. In seinem vielbeachteten Disput mit Papst Benedikt XVI. gab der Philosoph Jürgen Habermas Ähnliches zu: das Christentum hat die Grundlagen für jenes Menschenbild geschaffen, das moderne freie Demokratien möglich machte. Es gibt sonst keine Religion, die lehrt, dass Gott Mensch wurde. Dass der Herr zum Knecht wurde und für den Sünder starb. Dass jeder ausnahmslos geliebt und wertvoll ist. Die Ideen der Menschenwürde und der Freiheit der Person ist heute Gemeinplatz in der westlichen Welt. Doch sie sind nicht selbstverständlich. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Präambel der bayerischen Verfassung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt: Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung. Mit der Debatte um das Kreuz im öffentlichen Raum wird eine wesentliche Frage berührt. Sie lautet: kann die Würde des Menschen, die Freiheit und Stabilität unserer Gesellschaft langfristig auf die Fundamente verzichten, auf denen sie historisch gewachsen sind? Der religiös unmusikalische Habermas gab sich hier zurückhaltend bis skeptisch. Betrachtet man jene Versuche, Gesellschaften ohne Religion zu bauen, so lässt sich mit Erschaudern feststellen, wie entsetzlich blutig diese Versuche im 20. Jahrhundert endeten. Man möge nicht vergessen: der Kommunismus verstand sich als gelebter Humanismus, in dem der Mensch befreit wird. Er verstand sich zudem als unmissverständlich atheistisch. Im öffentlichen Diskurs wünscht man Christen mehr Mut, die schlichte Wahrheit zu sagen: die Versuche, eine Gesellschaft ohne christliche Fundamente zu bauen, haben bisher immer Entsetzliches hervorgebracht. Weshalb sollten wir Euch diesmal glauben? Denn darum geht es im Letzten jenen, die Gottesbezüge aus der Verfassung ebenso tilgen wollen wie die Kreuze aus den Klassenzimmern: es geht um eine Marginalisierung des Christentums. Eine Gesellschaft ohne das Kreuz Jesu und wofür es steht. Erstaunlicher Weise sind es eben die weltoffen-toleranten Linken, die begeistert Vielfalt! rufen, wenn sich Religion im öffentlichen Leben zeigt, außer freilich es handelt sich um die christliche oder (viel zu provokativ!) die jüdische. Es waren nicht einfach die Werte der Aufklärung, die aus dem Nichts den demokratischen Staat erschaffen haben. Es war vielmehr das biblische Menschenbild, die christliche Positivbewertung von Verstand, Wissenschaft und Marktwirtschaft, die den Aufstieg des Westens und auch die Entstehung der Aufklärung erst ermöglich haben. Wo dies mitunter gegen den Widerstand der Kirche durchgesetzt werden musste, gelang das eben aus demselben Grund, weshalb es im Iran ganz offensichtlich deutlich weniger leicht gelingt: weil es in der christlichen Religion selbst Grundlagen gab, die sich sogar gegen religiöse Institutionen durchzusetzen imstande waren. Nein, es ist kein Zufall, dass die Demokratie sich in christlichen Ländern durchsetzte und dauerhaft halten konnte. Jene, die heute laut rufen, der Staat könne doch spielend auf diese historischen Wurzeln verzichten, verdienen unser Vertrauen nicht mehr als jene, die im 20. Jahrhundert ein von den Fesseln des Christentums befreites Utopia versprachen und blutgetränkte Trümmer hinterließen. Dr. theol. Johannes Hartl ist Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg und Familienvater. #MEHR2018 - Johannes Hartl (Leiter des Gebetshauses Augsburg) beim Eröffnungsvortrag Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuGebetshaus Augsburg
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

