 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
| 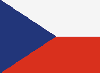 Spannungen zwischen Kirche und Staat in Tschechien14. April 2004 in Weltkirche, keine Lesermeinung Die tschechische Kirche wächst auf steinigem Boden: KATH.NET-Mitarbeiter Gebhard Klötzl analysiert den Hintergrund für die gegenwärtige schwierige Lage. Prag (www.kath.net, gk) Die tschechische Republik ist das einzige Land unter den EU-Beitrittsländern, das auch 14 Jahre nach dem Ende des Kommunismus seine Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl noch immer nicht durch ein Konkordat oder einen vergleichbaren Grundlagenvertrag geordnet hat. Der Atheismus der Bevölkerungsmehrheit und antikatholische Ressentiments in den politischen Führungskreisen sind der Nährboden ständiger Spannungen im Verhältnis Kirche - Staat, die sich kurz vor Ostern in einem medialen Schlagabtausch zwischen dem Prager Kardinal Miroslav Vlk und Staatspräsident Vaclav Klaus entluden. Was ist der Hintergrund dieser Entwicklung? Für die katholische Kirche war Böhmen seit Beginn der Neuzeit ein steiniger Boden. Nach der Verbrennung von Jan Hus 1415 auf dem Konzil von Konstanz hingen weite Teile der Bevölkerung seiner Hussitenbewegung an. Die habsburgische Gegenreformation drang vielfach nicht in die Tiefe der Herzen, jedenfalls wurde die katholische Kirche hier nie zu einer breit verankerten Volkskirche wie im benachbarten Polen. Im bäuerlich-katholischen Mähren war die Situation immer etwas besser und ist es heute noch. Nach dem Ersten Weltkrieg unterstützte der neue tschecho-slowakische Staat massiv eine Übertrittsbewegung in eine von Rom abgespaltene tschechische Nationalkirche, die den Katholizismus innerhalb kürzester Zeit um 1,3 Millionen Gläubige brachte. 1921 waren in Tschechien (mit 33% deutscher Bevölkerung) noch 82 Prozent Katholiken. Und auch nach dem zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Deutschen waren noch 76% (1948) der Bevölkerung katholisch. Doch mit der kommunistischen Machtergreifung 1948 wurde die Kirche verboten, Gläubige verfolgt und unterdrückt, der Atheismus als "Staatsreligion" eingeführt. Das Ergebnis sind heute nur noch 27 Prozent Katholiken, ein Prozent je evangelisch (Böhmische Brüdergemeinde) und Hussiten, drei Prozent andere Religionen. 68 Prozent (!) der Tschechen sind ohne Konfession. Durch die Abspaltung der stark katholischen Slowakei im Jahr 1993 blieb ein Staat zurück, in welchem die Religiosität nach einer Studie des Pastoraltheologen Paul Zulehner (1997) am untersten Ende der europäischen Skala anzusetzen ist. Nach der Samtenen Revolution von 1989 erlangte die katholische Kirche, die institutionell fast ausgelöscht war, wohl wieder die Religionsfreiheit und erhielt in einer ersten, provisorischen Tranche eine ganze Reihe von Kirchen und Klostergebäuden zurück. Danach hätte für ein gedeihliches Wirken der Kirche ein Konkordat oder ein vergleichbarer Grundlagenvertrag zwischen Kirche und Staat folgen müssen, der die Fragen des Religionsunterrichtes, der Militär-, Gefängnis- und Spitalsseelsorge, der karitativen Aktivitäten sowie die endgültige Vermögensrückgabe regelt. Es folgten jahrelange, zähe Verhandlungen zwischen wechselnden tschechischen Regierungen und dem Heiligen Stuhl. In dieser Phase beging die tschechische Kirche in einigen Fällen die Ungeschicklichkeit, ihr zurückgegebene Gebäude, vor allem im boomenden Prag, lukrativ zu vermieten, anstatt für sich selbst zu nutzen. Da sie auf Spenden ihrer - wenigen - Gläubigen stark angewiesen ist, war das wirtschaftlich zwar verständlich, lieferte aber ihren Gegnern emotionale Munition gegen weitere Vermögensrückgaben. Die Regierung des ehemaligen Kommunisten Milos Zeman produzierte 1999 ein Rechtsgutachten, wonach die Kirche überhaupt keine juristischen Ansprüche auf Vermögensrückgaben habe - alles was sie bekomme, sei Großzügigkeit des Staates. Präsident Havel schaltete sich daraufhin ein und verhinderte einen völligen Gesprächsabbruch. Der apostolische Nuntius koppelte 2001 die Frage der Vermögensrestitution von den Konkordatsverhandlungen ab, um das für die Seelsorge so wichtige Vertragswerk endlich zu einem Abschluss zu bringen. 2003 schien der Erfolg zum Greifen nahe: Eine Regierungsdelegation unter Führung des christdemokratischen Außenministers Cyril Svoboda und der Heilige Stuhl paraphierten einen ausgearbeiteten Konkordatstext - doch zum Entsetzen der Kirche lehnte das tschechische Parlament das Konkordat mit 110 von 177 Stimmen ab. Außer den Christdemokraten hatten nahezu alle Abgeordneten dagegen gestimmt. Der Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz, Daniel Hermann, führte diese Ablehnung auf mangelnde Kenntnis der Verhältnisse, auf immer noch bestehende Vorurteile aus der Zeit der kommunistischen Gehirnwäsche und auf einen, wörtlich, unübersehbaren bösen Willen zurück. Auch Minister Svoboda warf den mit unzähligen Einzelargumenten operierenden parlamentarischen Gegnern des Konkordatstextes vor, dass sie nicht den Mut besäßen, zuzugeben, dass sie einfach kein Konkordat mit der katholischen Kirche wollten. Als Reaktion auf diesen Rückschlag forderte der Heilige Stuhl die Prager Regierung in einer diplomatischen Note auf, ihre Vorstellungen von der weiteren Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen darzulegen. Ende 2003 traf sich Erzbischof Kardinal Vlk mit dem neuen Staatspräsidenten Klaus auf der Prager Burg zu einem Gipfelgespräch. Doch nach dem Abtritt des an sich agnostischen, aber der Kirche wohlwollenden Präsidenten Havel ist es für die katholische Kirche noch schwieriger geworden. Präsident Klaus ist Angehöriger der hussitischen Kirche und offenbar erfüllt von Ressentiments gegen den Katholizismus, dem er absolut nichts zugestehen möchte, was in seinen Augen ein Vorrecht oder Privileg sein könnte. Anfang des heurigen Jahres maßregelte er sogar den christdemokratischen Außenminister Svoboda und drohte ihm an, ihm die weiteren Konkordatsverhandlungen zu entziehen, falls er zuviele Zugeständnisse mache. Mitte März 2004 ist der mittlerweile dritte apostolische Nuntius seit dem Ende des Kommunismus, Diego Causera, in Prag eingetroffen. In einer ersten Erklärung stellte er fest, die katholische Kirche verlange keineswegs Privilegien, der Heilige Stuhl habe aber auch keinen festen Termin für die Fertigstellung eines Konkordates vorherbestimmt. Ungefähr zur selben Zeit mahnte der Prager Weihbischof Vaclav Maly, ehemals Dissident und Opfer der Kirchenverfolgung, eine stärkere Aufarbeitung der Zeit vor der Wende ein. Viele Tschechen hätten sich noch nicht klar von ihrer Vergangenheit distanziert, sagte Maly in der Katholischen Akademie Berlin und meinte damit zweifellos auch hohe Politiker des heutigen Tschechien. Kurz vor Ostern gab es dann einen heftigen medialen Schlagabtausch zwischen Kardinal Vlk und Präsident Klaus, der auch in den deutschsprachigen Medien Widerhall fand. Der Abschluss des von der tschechischen Kirche dringend benötigten Grundlagenvertrages über ihre Tätigkeit in Staat und Gesellschaft ist damit in noch weitere Ferne gerückt. Schon 1997 sagte Kardinal Vlk auf einem Symposium: Es gibt keine schnelle und einfache Therapie für die Krankheit des Atheismus. Leider geben ihm die Ereignisse derzeit recht. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuTschechien
|        Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
