 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
| 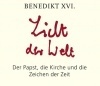 'Licht der Welt' und die helle Zukunft des Christentums23. November 2010 in Aktuelles, 2 Lesermeinungen Benedikt XVI. und die kontinuierliche Revolution. Einblicke und Weitblicke. Eine kleine Anthologie über das Buch des Jahres - Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Eigentlich hätte man es erwarten können und dann auch wieder nicht. Am Wochenende des Konsistoriums veröffentlichte die vatikanische Zeitung LOsservatore Romano Auszüge aus dem Interviewbuch Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Der Journalist und Publizist Peter Seewald hatte in diesem Sommer Benedikt XVI. während seines Aufenthalts in Castel Gandolfo zu mehreren Unterredungen getroffen. Das Ergebnis ist nun dieses historisches Buch, da sich bisher noch kein Papst in dieser Weise geäußert hatte. Um Polemiken vorwegzunehmen: Es sei dahingestellt, ob es geeignet ist, dass sich ein Papst in dieser Weise gegenüber der Öffentlichkeit präsentiert. Er hat es getan und gestattet somit einer breiten Leserschaft einen Einblick in seine innersten Beweggründe, in den Kern seiner Botschaft und Lehre. Nie entsteht der Eindruck, als sitze der Papst wie irgendein Interviewpartner auf der Couch. Keiner noch so brennenden Frage wird ausgewichen. Benedikt XVI. offenbart sich einmal mehr als revolutionärer Papst. Jedes Klischee zerbricht, wenn man sich die Mühe macht, seinem Denken, seiner Person und dem von ihm eingenommenen Amt zu folgen. Von Licht ist die Rede: ein Licht, das es dem Papst ermöglicht, alles und jeden aus dem Blickwinkel des einen liebenden Gottes zu sehen. Leider gab es im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des Buches natürlich wieder einen Skandal, der nicht zuletzt durch eine etwas unkluge Vorgehensweise bei der Vorabveröffentlichung eines kleinen Abschnittes verursacht wurde und mit dem Stichwort Kondom für Aufregung sorgte. Von einer Wende im Vatikan und ähnlichem war die Rede, Papst lockert Kondomverbot hieß es. Die Medien stürzten sich auf diese neue Weisheit und vergaßen nachzufragen, worüber der Papst denn gesprochen hat. Denn: nicht di Morallehre der Kirche steht zur Debatte, sondern die Art und Weise, wie dem Problem der Aids-Krankheit am Besten begegnet werden kann, dies im Zusammenhang mit den Äußerungen des Papstes zum Problem AIDS im Rahmen seiner Afrikareise im März 2009, als er bereits deutlich gemacht hatte: ein so schwerwiegendes Problem muss damit angegangen werden, dass der Zusammenhang von Sexualität und Verantwortung betont und ausgearbeitet wird. Heute spricht der Papst von der Notwendigkeit einer Vermenschlichung der Sexualität.
Die Afrika-Reise ist publizistisch völlig verdrängt worden durch einen einzigen Satz. Man hatte mich gefragt, warum die katholische Kirche in Sachen Aids eine unrealistische und wirkungslose Position einnehme. Daraufhin fühlte ich mich nun wirklich herausgefordert, denn sie tut mehr als alle anderen. Und das behaupte ich auch weiterhin. Weil sie als einzige Institution ganz nah und ganz konkret bei den Menschen ist, präventiv, erziehend, helfend, ratend, begleitend. Weil sie so viele Aidskranke und insbesondere an Aids erkrankte Kinder behandelt wie niemand sonst. Ich konnte eine dieser Stationen besuchen und mit den Kranken sprechen. Das war die eigentliche Antwort: Die Kirche tut mehr als die anderen, weil sie nicht nur von der Tribüne der Zeitung aus redet, sondern den Schwestern, den Brüdern vor Ort hilft. Ich hatte dabei nicht zum Kondomproblem generell Stellung genommen, sondern, was dann zum großen Ärgernis wurde, nur gesagt: Man kann das Problem nicht mit der Verteilung von Kondomen lösen. Es muss viel mehr geschehen. Wir müssen nahe bei den Menschen sein, sie führen, ihnen helfen; und dies sowohl vor wie nach einer Erkrankung. Tatsächlich ist es ja so, dass wo immer sie jemand haben will, Kondome auch zur Verfügung stehen. Aber dies allein löst eben die Frage nicht. Es muss mehr geschehen. Inzwischen hat sich gerade auch im säkularen Bereich die sogenannte ABC-Theorie entwickelt, die für Abstinence Be faithful Condom steht [Enthaltsamkeit Treue Kondom], wobei das Kondom nur als Ausweichpunkt gemeint ist, wenn die beiden anderen Punkte nicht greifen. Das heißt, die bloße Fixierung auf das Kondom bedeutet eine Banalisierung der Sexualität, und die ist ja gerade die gefährliche Quelle dafür, dass so viele Menschen in der Sexualität nicht mehr den Ausdruck ihrer Liebe finden, sondern nur noch eine Art von Droge, die sie sich selbst verabreichen. Deshalb ist auch der Kampf gegen die Banalisierung der Sexualität ein Teil des Ringens darum, dass Sexualität positiv gewertet wird und ihre positive Wirkung im Ganzen des Menschseins entfalten kann. Es mag begründete Einzelfälle geben, etwa wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet, wo dies ein erster Schritt zu einer Moralisierung sein kann, ein erstes Stück Verantwortung, um wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will. Aber es ist nicht die eigentliche Art, dem Übel der HIV-Infektion beizukommen. Diese muss wirklich in der Vermenschlichung der Sexualität liegen. Heißt das nun, dass die katholische Kirche gar nicht grundsätzlich gegen die Verwendung von Kondomen ist? Sie sieht sie natürlich nicht als wirkliche und moralische Lösung an. Im einen oder anderen Fall kann es in der Absicht, Ansteckungsgefahr zu verringern, jedoch ein erster Schritt sein auf dem Weg hin zu einer anders gelebten, menschlicheren Sexualität.
In Zeichen der Zeit äußert sich der Papst zum Missbrauchsskandal in der Kirche, zu den Ursache und Chancen der Krise, zum Problem einer globalen Katasrophe, dem Wirken der Diktatur des Relativismus, um in die Zeit der Umkehr hineinzuführen. Das dem Pontifikat gewidmete Kapitel erläutert, wie Benedikt XVI. sein Amt sieht. Der Papst betont die Wichtigkeit seiner Apostolischen Reisen, die wichtigen Schritte in der Ökumene und im Dialog mit dem Islam und scheut es nicht, erneut aufrichtig auf die Problematik des Falls Williamson einzugehen. Der dritte Teil des Buches erörtert den Zustand und die Schwierigkeiten der Kirche heute und betont Sinn und Wesen der Umkehr für die Zukunft des Glaubens, um mit den letzten Dingen zu enden. Eine kleine Anthologie aus Licht der Welt Das Christentum Durch mein ganzes Leben hat sich immer auch die Linie hindurchgezogen, dass Christentum Freude macht, Weite gibt. Schließlich könnte man als einer, der immer nur dagegen ist, das Leben wohl auch gar nicht ertragen. Aber gleichzeitig war immer gegenwärtig, wenn auch in unterschiedlichen Dosierungen, dass das Evangelium gegen machtvolle Konstellationen steht. Dies war in meiner Kindheit und Jugend bis zum Kriegsende natürlich besonders drastisch. Seit den 1968er Jahren geriet der christliche Glaube dann in den Gegensatz zu einem neuen Gesellschaftsentwurf, so dass er immer wieder gegen machtvoll auftrumpfende Meinungen bestehen musste. Anfeindungen zu ertragen und Widerstand zu leisten, gehört also dazu ein Widerstand aber, der dazu dient, das Positive ins Licht zu bringen. Der Papst ein Bettler: Was den Papst angeht, so ist auch er ein einfacher Bettler vor Gott mehr noch als alle anderen Menschen. Natürlich bete ich zuallererst immer zu unserem Herrn, mit dem mich einfach sozusagen diese alte Bekanntschaft verbindet. Aber ich rufe auch die Heiligen an. Ich bin mit Augustinus, mit Bonaventura, mit Thomas von Aquin befreundet. Man sagt dann auch zu solchen Heiligen: Helft mir! Und die Mutter Gottes ist ohnehin immer ein großer Bezugspunkt. In diesem Sinn gebe ich mich in die Gemeinschaft der Heiligen hinein. Mit ihnen, durch sie bestärkt, rede ich dann auch mit dem Lieben Gott, vor allem bettelnd, aber auch dankend oder ganz einfach freudig. Unfehlbar? Der Begriff der Unfehlbarkeit hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Er entstand angesichts der Frage, ob es irgendwo eine letzte Instanz gibt, die entscheidet. Das Erste Vatikanische Konzil hat, einer langen Tradition aus der Zeit der Urchristenheit folgend, schließlich festgehalten: Es gibt eine letzte Entscheidung! Es bleibt nicht alles offen! Der Papst kann in bestimmten Umständen und unter bestimmten Bedingungen letztverbindliche Entscheidungen treffen, durch die klar wird, was der Glaube der Kirche ist und was nicht. Was nicht heißt, dass der Papst ständig Unfehlbares produzieren kann. Für gewöhnlich handelt der Bischof von Rom wie jeder andere Bischof auch, der seinen Glauben bekennt, der ihn verkündigt, der treu ist in der Kirche. Nur wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, wenn die Tradition geklärt ist und er weiß, dass er jetzt nicht willkürlich handelt, kann der Papst sagen: Dies ist der Glaube der Kirche und das Nein dazu ist nicht der Glaube der Kirche. In diesem Sinn hat das Erste Vatikanische Konzil die Fähigkeit zur Letztentscheidung definiert, damit der Glaube seine Verbindlichkeit behält. Der Skandal des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker Die Sache kam für mich nicht ganz unerwartet. Ich hatte schon in der Glaubenskongregation mit den amerikanischen Fällen zu tun; ich hatte auch die Situation in Irland heraufsteigen sehen. Aber in dieser Größenordnung war es trotzdem ein unerhörter Schock. Seit meiner Wahl auf den Stuhl Petri hatte ich mich bereits mehrfach mit Opfern sexuellen Missbrauchs getroffen. Dreieinhalb Jahre zuvor, im Oktober 2006, hatte ich in meiner Ansprache an die Bischöfe von Irland gefordert, die Wahrheit ans Licht zu bringen, alles Notwendige zu tun, damit sich derartige ungeheuerliche Verbrechen nicht wiederholen, die Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit zu achten und, vor allem, den Opfern Heilung zu bringen. Das Priestertum plötzlich so verschmutzt zu sehen, und damit die katholische Kirche selbst, in ihrem Innersten, das musste man wirklich erst verkraften. Aber es galt, nicht zugleich den Blick dafür zu verlieren, dass es in der Kirche das Gute gibt und nicht nur diese schrecklichen Dinge. Strafe Heute müssen wir wieder neu erlernen, dass die Liebe zu dem Sünder und die Liebe zu dem Geschädigten dadurch im rechten Ausgleich stehen, dass ich den Sünder in der Form bestrafe, die möglich und die angemessen ist. Insofern gab es in der Vergangenheit eine Bewusstseinsveränderung, durch die eine Verdunkelung des Rechts und der Notwendigkeit von Strafe eingetreten ist letztendlich auch eine Verengung des Begriffs von Liebe, die eben nicht nur Nettigkeit und Artigkeit ist, sondern die in der Wahrheit ist. Und zur Wahrheit gehört auch, dass ich denjenigen strafen muss, der gegen die wirkliche Liebe gesündigt hat. Der Missbrauchsskandal und die Medien Dass nicht nur der reine Wille zur Wahrheit diese Presseaufklärung geleitet hat, sondern dass es auch eine Freude gab, die Kirche bloßzustellen und möglichst zu diskreditieren, war nicht zu übersehen. Aber dessen ungeachtet musste immer klar bleiben: Soweit es Wahrheit ist, müssen wir für jede Aufklärung dankbar sein. Die Wahrheit, verbunden mit der richtig verstandenen Liebe, ist der Wert Nummer eins. Und schließlich hätten die Medien nicht in dieser Weise berichten können, wenn es nicht in der Kirche selbst das Böse gäbe. Nur weil in der Kirche das Böse war, konnte es von anderen gegen sie ausgespielt werden. Rücktritt? Wenn die Gefahr groß ist, darf man nicht davonlaufen. Deswegen ist das sicher nicht der Augenblick, zurückzutreten. Gerade in so einem Augenblick muss man standhalten und die schwere Situation bestehen. Das ist meine Auffassung. Zurücktreten kann man in einer friedlichen Minute, oder wenn man einfach nicht mehr kann. Aber man darf nicht in der Gefahr davonlaufen und sagen, es soll ein anderer machen. Wenn ein Papst zur klaren Erkenntnis kommt, dass er physisch, psychisch und geistig den Auftrag seines Amtes nicht mehr bewältigen kann, dann hat er ein Recht und unter Umständen auch eine Pflicht, zurückzutreten Die abhandengekommene Buße Der Begriff Buße, der zu den Grundelementen der alttestamentlichen Botschaft gehört, ist uns zunehmend abhanden gekommen. Man wollte irgendwie nur noch das Positive sagen. Aber das Negative existiert eben, es ist ein Faktum. Dass man durch Buße ändern und sich ändern lassen kann, ist eine positive Gabe, ein Geschenk. So hat es auch die Alte Kirche gesehen. Es gilt, nun im Geist der Buße wirklich neu anzufangen und gleichzeitig die Freude am Priestertum nicht zu verlieren, sondern neu zu gewinnen. Das Böse und die Kirche Das Böse wird auch immer zum Geheimnis der Kirche gehören. Und wenn man sieht, was Menschen, was Kleriker alles in der Kirche gemacht haben, dann ist das geradezu ein Beweis dafür, dass Er die Kirche hält und gegründet hat. Wenn sie nur von den Menschen abhinge, wäre sie längst zugrunde gegangen. Fortschritt? Dass wir nicht auf ewig hier bleiben, sagt uns die Heilige Schrift, und das sagt uns auch die Erfahrung. Aber sicher machen wir etwas falsch. Ich denke, hier kommt die Problematik des Begriffs Fortschritt zum Tragen. Die Neuzeit hat sich ihren Weg unter den Grundbegriffen Fortschritt und Freiheit gesucht. Aber was ist Fortschritt? Heute sehen wir, dass der Fortschritt auch zerstörerisch sein kann. Insofern müssen wir reflektieren, welche Kriterien wir finden müssen, damit Fortschritt auch wirklich Fortschritt ist. Die Notwendigkeit einer Gewissenserforschung Es müsste heute eine große Gewissenserforschung einsetzen. Was ist wirklich Fortschritt? Ist es Fortschritt, wenn ich zerstören kann? Ist es Fortschritt, wenn ich Menschen selber machen, selektieren und beseitigen kann? Wie kann Fortschritt ethisch und menschlich bewältigt werden? Aber nicht nur die Kriterien des Fortschritts müssten neu bedacht werden. Es geht neben der Erkenntnis und dem Fortschritt auch um den anderen Grundbegriff der Neuzeit: um die Freiheit. Die als Freiheit verstanden wird, alles machen zu können. Humanökologie Dass es eine Vergiftung des Denkens gibt, die uns schon im Voraus in falsche Perspektiven hineinführt, ist nicht zu übersehen. Uns davon wieder zu befreien mittels einer wirklichen Bekehrung, um dieses Grundwort des christlichen Glaubens zu benutzen, ist eine der Herausforderungen, deren Evidenz inzwischen allgemein sichtbar wird. In unserer so wissenschaftlich und modern ausgerichteten Welt hatten solche Begriffe keine Bedeutung mehr. Eine Bekehrung im Sinn des Glaubens auf einen Willen Gottes hin, der uns einen Weg weist, das galt als altmodisch und überholt. Ich glaube, langsam aber wird sichtbar, dass etwas dran ist, wenn wir sagen, dass wir uns neu besinnen müssen. Diktatur des Relativismus und die wahre Intoleranz Dass im Namen der Toleranz die Toleranz abgeschafft wird, ist eine wirkliche Bedrohung, vor der wir stehen. Die Gefahr ist, dass die Vernunft die sogenannte westliche Vernunft behauptet, sie habe nun wirklich das Richtige erkannt, und damit einen Totalitätsanspruch erhebt, der freiheitsfeindlich ist. Ich glaube, diese Gefahr müssen wir sehr nachdrücklich darstellen. Niemand wird gezwungen, Christ zu sein. Aber niemand darf gezwungen werden, die neue Religion als die allein bestimmende und die ganze Menschheit verpflichtende leben zu müssen. Das Kreuz mit dem Kreuz Hier ist erstens die Frage zu stellen: Warum muss er es verbannen? Wenn das Kreuz eine Aussage beinhalten würde, die für andere nicht nachvollziehbar und unzumutbar ist, wäre das schon eher bedenkenswert. Aber das Kreuz beinhaltet, dass Gott selbst ein Leidender ist, dass er uns durch Leiden lieb hat, dass er uns liebt. Das ist eine Aussage, die niemanden angreift. Das ist das eine. Zum anderen gibt es natürlich auch eine kulturelle Identität, auf der unsere Länder beruhen. Eine Identität, die unsere Länder positiv formt und von innen her trägt und die immer noch die positiven Werte und die Grundform der Gesellschaft bildet, durch die der Egoismus in seine Grenzen gewiesen wird und eine Kultur der Menschlichkeit möglich ist. Ich würde sagen, ein solcher kultureller Selbstausdruck einer Gesellschaft, die davon positiv lebt, kann niemanden, der die Überzeugung nicht teilt, beleidigen, und er darf auch nicht verbannt werden Der Moscheenstreit und das Burkaverbot Christen sind tolerant, und insofern lassen sie auch den anderen ihr Selbstverständnis. Wir sind dankbar, dass es in den Ländern am Arabischen Golf (Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait) Kirchen gibt, in denen die Christen Gottesdienst feiern können, und wünschen, dass es überall so wird. Deswegen ist es selbstverständlich, dass Muslime auch bei uns sich in Moscheen zum Gebet versammeln können. Was die Burka angeht, sehe ich keinen Grund für ein generelles Verbot. Man sagt, manche Frauen würden die Burka gar nicht freiwillig tragen und sie sei eigentlich eine Vergewaltigung der Frau. Damit kann man natürlich nicht einverstanden sein. Wenn sie sie aber freiwillig tragen wollen, weiß ich nicht, warum man sie ihnen verbieten muss. Christsein und die Neuevangelisierung Das Christsein darf nicht zu einer Art archaischer Schicht werden, die ich irgendwie festhalte und gewissermaßen neben der Modernität lebe. Es ist selbst etwas Lebendiges, etwas Modernes, das meine gesamte Modernität durchformt und gestaltet und sie insofern regelrecht umarmt. Dass hier ein großes geistiges Ringen erforderlich ist, habe ich nicht zuletzt jüngst durch die Gründung eines Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung zum Ausdruck gebracht. Wichtig ist, dass wir versuchen, das Christentum so zu leben und zu denken, dass es die gute, die rechte Moderne in sich aufnimmt und zugleich sich dann von dem scheidet und unterscheidet, was eine Gegenreligion wird. Drogen, Sex und die Zerstörung des Menschlichen Ganz viele Bischöfe, vor allen Dingen aus Lateinamerika, sagen mir, dass da, wo die Straße des Drogenanbaus und Drogenhandels verläuft und das sind große Teile dieser Länder , es so ist, wie wenn ein böses Untier seine Hand auf das Land gelegt hätte und die Menschen verdirbt. Ich glaube, diese Schlange des Drogenhandels und -konsums, die die Erde umspannt, ist eine Macht, von der wir uns nicht immer die gebührende Vorstellung machen. Sie zerstört die Jugend, sie zerstört Familien, sie führt zur Gewalt und gefährdet die Zukunft ganzer Länder. Auch dies gehört zu den schrecklichen Verantwortungen des Westens, dass er Drogen braucht, und dass er damit Länder schafft, die ihm das zuführen müssen, was sie am Ende verbraucht und zerstört. Da ist eine Gier nach Glück entstanden, die sich mit dem Bestehenden nicht begnügen kann. Und die dann in das Paradies des Teufels, wenn man so sagen will, flüchtet und Menschen rundum zerstört. Man sieht, der Mensch erstrebt eine unendliche Freude, er möchte Lust bis zum Äußersten, möchte das Unendliche. Aber wo es Gott nicht gibt, wird es ihm nicht gewährt, kann es nicht sein. Da muss er nun selber das Unwahre, die unwahre Unendlichkeit schaffen. III. Vatikanisches Konzil? Nun, Johannes XXIII. hat einen großen und nicht wiederholbaren Gestus gemacht, indem er einem universalen Konzil anvertraut hat, das Wort des Glaubens heute neu zu verstehen. Vor allen Dingen hat das Konzil den großen Auftrag nachgeholt und eingelöst, sowohl die Bestimmung als auch die Relation der Kirche zur Neuzeit und auch die Beziehung des Glaubens zu dieser Zeit mit ihren Werten neu zu definieren. Aber das Gesagte dann in Existenz umzusetzen und dabei in der inneren Kontinuität des Glaubens zu bleiben, ist ein viel schwierigerer Prozess als das Konzil selbst. Zumal das Konzil in der Interpretation der Medien in die Welt gekommen ist und weniger mit seinen eigenen Texten, die kaum von jemand gelesen werden. Im Moment brauchen wir vor allem geistliche Bewegungen, in denen die Weltkirche, aus den Erfahrungen der Zeit schöpfend und zugleich aus der inneren Erfahrung des Glaubens und seiner Kraft kommend, Wegmarken setzt und damit die Präsenz Gottes wieder zum Kernpunkt macht. Der Papst Dass es ein ungeheures Amt ist, realisiert man sehr schnell. Wenn man weiß, dass man schon als Kaplan, als Pfarrer, als Professor eine große Verantwortung trägt, lässt sich leicht extrapolieren, welche ungeheure Last auf demjenigen liegt, der Verantwortung für die ganze Kirche trägt. Aber da muss einem natürlich umso mehr bewusst sein, dass man das nicht alleine macht. Dass man es einerseits mit der Hilfe Gottes macht, andererseits in einer großen Zusammenarbeit. Das Zweite Vatikanum hat uns mit Recht gelehrt, dass für die Struktur der Kirche Kollegialität konstitutiv ist; dass der Papst nur ein Erster im Miteinander sein kann, und nicht jemand, der als absoluter Monarch einsame Entscheidungen treffen und alles selber machen würde. Vernunft und Glaube Jesus selbst hat den Glauben durchaus verständlich gemacht, indem er ihn mit der inneren Einheit und in der Kontinuität mit dem Alten Testament, mit den ganzen Führungen Gottes dargestellt hat: als den Glauben an den Gott, der der Schöpfer und der Herr der Geschichte ist, für den die Geschichte zeugt und von dem die Schöpfung spricht. Es ist interessant, dass diese wesentliche Rationalität schon im Alten Testament zum Grundbestand des Glaubens gehört; dass dann insbesondere in der Zeit des Babylonischen Exils gesagt wird: Unser Gott ist nicht irgendeiner von den vielen, er ist der Schöpfer, der Gott des Himmels, der einzige Gott. Damit wird ein Anspruch erhoben, dessen Universalität gerade auch auf seiner Vernünftigkeit beruht. Dieser Kern wurde später der Begegnungspunkt zwischen Altem Testament und Griechentum. Denn ungefähr in der gleichen Zeit, in der das Babylonische Exil diesen Zug im Alten Testament besonders heraushebt, entsteht auch die griechische Philosophie, die nun über die Götter hinaus nach dem einen Gott fragt. Es bleibt der große Auftrag der Kirche, dass sie Glaube und Vernunft, das Hinausschauen über das Greifbare und zugleich die rationale Verantwortung miteinander verbindet. Denn die ist uns ja von Gott gegeben. Sie ist das, was den Menschen auszeichnet. Das deutsche Charisma? Sie haben darauf hingewiesen, dass zur deutschen Kulturgeschichte besonders auch die Nachdenklichkeit gehört. Dieses Element wurde lange Zeit als herausstechend angesehen. Heute würde man vielleicht eher Talente wie Tatkraft, Energie oder Durchsetzungsvermögen als typisch deutsch ansehen. Ich denke, Gott wollte, wenn er schon einen Professor zum Papst machte, dass eben dieses Moment der Nachdenklichkeit und gerade das Ringen um die Einheit von Glaube und Vernunft in den Vordergrund komme.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass mir vom ersten Tag meines Theologiestudiums an die innere Einheit von Altem und Neuem Bund, der beiden Teile unserer Heiligen Schrift, irgendwie sofort klar war. Mir war aufgegangen, dass wir das Neue Testament nur zusammen mit dem Vorangegangenen lesen können, ansonsten würden wir es gar nicht verstehen. Dann hat natürlich uns als Deutsche getroffen, was im Dritten Reich geschehen war, und uns erst recht angehalten, mit Demut und Scham und mit Liebe auf das Volk Israel zu schauen. Diese Dinge haben sich, wie gesagt, bereits in meiner theologischen Ausbildung miteinander verbunden und meinen Weg im theologischen Denken geformt. Deshalb war es für mich klar auch hier in voller Kontinuität mit Papst Johannes Paul II. , dass dieses neue, liebende, verstehende Ineinander von Israel und Kirche im jeweiligen Respekt für das Sein des anderen und seine eigene Sendung wesentlich sein muss für meine Verkündigung des christlichen Glaubens Ökumene und Protestantismus Zunächst muss man die große Vielschichtigkeit des weltweiten Protestantismus bedenken. Das Luthertum ist ja nur eines der Teile im Spektrum des Weltprotestantismus. Daneben gibt es die Reformierten, die Methodisten und so fort. Dann ist da das große neue Phänomen der Evangelikalen, die sich mit einer ungeheuren Dynamik ausbreiten und im Begriff sind, in den Ländern der Dritten Welt die ganze religiöse Szenerie zu verändern. Wenn man also von einem Dialog mit dem Protestantismus spricht, muss man diese Vielschichtigkeit vor Augen haben, die auch von Land zu Land wieder verschieden ist. Man muss tatsächlich feststellen, dass der Protestantismus Schritte getan hat, die ihn eher von uns entfernen; mit der Frauenordination, der Akzeptanz homosexueller Partnerschaften und dergleichen mehr. Es gibt auch andere ethische Stellungnahmen, andere Konformismen mit dem Geist der Gegenwart, die das Gespräch erschweren. Zugleich gibt es natürlich auch in den protestantischen Gemeinschaften Menschen, die lebhaft zur eigentlichen Substanz des Glaubens hindrängen und diese Haltung ihrer Großkirchen nicht billigen. Wir sollten deshalb sagen: Wir müssen als Christen eine gemeinsame Basis finden; wir müssen als Christen imstande sein, in dieser Zeit eine gemeinsame Stimme zu den großen Fragen zu haben und Christus als den lebendigen Gott zu bezeugen. Die volle Einheit können wir in absehbarer Zeit nicht bewerkstelligen, aber tun wir, was möglich ist, um wirklich als Christen in dieser Welt gemeinsam einen Auftrag zu erfüllen, ein Zeugnis zu geben. Summorum pontificum und die erneuerte Liturgie Liturgie ist in Wahrheit ein Vorgang, durch den man sich hineinführen lässt in das große Glauben und Beten der Kirche. Aus diesem Grund haben die frühen Christen nach Osten, zur aufgehenden Sonne hin gebetet, dem Sinnbild des wiederkehrenden Christus. Sie wollten damit zeigen, dass die ganze Welt auf Christus zugeht und Er diese Welt ganz umfasst. Dieser Zusammenhang mit Himmel und Erde ist sehr wichtig. Die alten Kirchen waren nicht von ungefähr so gebaut, dass die Sonne in einem ganz bestimmten Augenblick ihr Licht in das Gotteshaus wirft. Gerade heute, da uns die Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen Erde und Weltall wieder bewusst wird, sollte man auch den kosmischen Charakter der Liturgie neu erkennen. Und ebenso den geschichtlichen. Dass diese nicht irgendwann irgendjemand einfach so erfunden hat, sondern dass sie seit Abraham organisch gewachsen ist. Solche Elemente aus frühester Zeit sind in der Liturgie enthalten. Was das Konkrete angeht, so ist die erneuerte Liturgie des Zweiten Vatikanums die gültige Form, wie die Kirche heute Liturgie feiert. Ich habe die vorangegangene Form vor allem deshalb besser zugänglich machen wollen, damit der innere Zusammenhang der Kirchengeschichte erhalten bleibt. Wir können nicht sagen: Vorher war alles verkehrt, jetzt ist alles richtig; denn in einer Gemeinschaft, in der das Beten und die Eucharistie das Allerwichtigste sind, kann nicht etwas ganz verkehrt sein, was früher das Allerheiligste war. Es ging um die innere Aussöhnung mit der eigenen Vergangenheit, die innere Kontinuität des Glaubens und Betens in der Kirche. Die sprungbereite Aggressivität und Deutschland. Der Fall Williamson Dass es im katholischen Deutschland eine beträchtliche Schicht gibt, die sozusagen darauf wartet, auf den Papst einschlagen zu können, ist eine Tatsache und gehört zu der Gestalt des Katholizismus in unserer Zeit. Womit wir uns ernstlich beschäftigen müssen, worum wir ringen müssen, ist, dass da wieder ein Grundeinverständnis entsteht. Die Kirche kommt von Christus her! Paulus begriff sie eben nicht als Institution, nicht als Organisation, sondern als lebendigen Organismus, in dem alle miteinander und zueinander wirken, in dem sie von Christus her geeint sind. Das ist ein Bild, aber ein Bild, das in die Tiefe führt und schon deswegen sehr realistisch ist, weil wir glauben, dass wir in der Eucharistie wirklich Christus, den Auferstandenen, empfangen. Und wenn jeder den gleichen Christus empfängt, sind wir alle wirklich in diesem neuen, auferstandenen Leib als dem großen Raum einer neuen Menschheit versammelt. Das zu verstehen ist wichtig, um von daher Kirche nicht als einen Apparat zu begreifen, der alles Mögliche machen muss der Apparat gehört auch dazu, aber in Grenzen , sondern als lebendigen Organismus, der von Christus selbst herkommt. Schisma innerhalb der katholischen Kirche? Zunächst einmal würde ich sagen, der Papst hat nicht die Macht, etwas zu erzwingen. Seine Macht besteht allein darin, dass Überzeugung da ist, dass die Menschen begreifen: Wir gehören zusammen, und der Papst hat einen Auftrag, den er sich nicht selbst gegeben hat. Nur wenn Überzeugung da ist, kann das Ganze gelingen. Nur durch die Überzeugung des gemeinsamen Glaubens kann die Kirche auch gemeinschaftlich leben. Ich bekomme so viele Briefe von einfachen Menschen wie auch prominenten Persönlichkeiten, die mir schreiben: Wir sind eins mit dem Papst, für uns ist er der Stellvertreter Christi und der Nachfolger Petri, seien Sie versichert, wir glauben und leben in der Gemeinschaft mit Ihnen. Natürlich gibt es immer schon, nicht erst jetzt, die zentrifugalen Kräfte, die Tendenz zu Nationalkirchen, die ja auch entstanden sind. Doch gerade heute, in der globalisierten Gesellschaft, in der Notwendigkeit einer inneren Einheit der Weltgemeinschaft, wird sichtbar, dass dies eigentlich Anachronismen sind. Es wird deutlich, dass eine Kirche nicht wächst, indem sie sich national einigelt, sich separiert und in einen bestimmten Kulturteil hineinsperrt und diesen verabsolutiert, sondern dass Kirche Einheit braucht, dass sie so etwas wie Primat braucht. Das zerfallende katholische Profil Nun, es sind eben die Kräfte des Zerfalls, die in der Menschenseele da sind. Hinzu kommt das Streben danach, beim Publikum anzukommen; oder auch, irgendeine Insel zu finden, wo es Neuland gibt und wir noch eigenständig gestalten können. Es geht dann entweder in die Richtung, dass man politischen Moralismus betreibt, wie es in der Befreiungstheologie und in anderen Experimenten der Fall war, um auf diese Weise sozusagen dem Christentum Gegenwärtigkeit zu geben. Oder es wandelt sich in Richtung Psychotherapie und Wellness, in Formen also, wo Religion damit identifiziert wird, dass ich irgendein ganzheitliches Wohlbefinden habe. Alle diese Versuche gehen daraus hervor, dass man die eigentliche Wurzel, den Glauben, weglässt. Was dann bleibt (...) sind selbstgemachte Projekte, die vielleicht einen begrenzten Lebenswert haben, die aber keine überzeugende Gemeinschaft mit Gott herstellen und auch die Menschen nicht bleibend miteinander verbinden können. Es sind Inseln, auf denen sich gewisse Leute ansiedeln, und diese Inseln sind vergänglicher Art, weil die Moden bekanntlich wechseln. Ehe und wiederverheiratet Geschiedene Einerseits gibt es die Gewissheit, dass der Herr uns sagt: Die Ehe, die im Glauben geschlossen ist, ist unauflösbar. Dieses Wort können wir nicht manipulieren. Wir müssen es so stehen lassen auch wenn es den Lebensformen widerspricht, die heute dominant sind. Es gab Epochen, in denen das Christliche so gegenwärtig war, dass die Unauflöslichkeit der Ehe die Norm war, aber in vielen Zivilisationen ist sie das nicht. Mir sagen immer wieder Bischöfe aus Ländern der Dritten Welt: Das Sakrament der Ehe ist das schwierigste von allen. Oder auch: Bei uns ist es noch gar nicht angekommen. Dieses Sakrament in Ausgleich zu bringen mit den herkömmlichen Weisen des Zusammenlebens, ist ein Vorgang, in den die ganze Existenz eingebunden ist, und ein Ringen, dessen Ausgang nicht erzwungen werden kann. Insofern ist das, was wir jetzt in der sich allmählich zersetzenden abendländischen Gesellschaft erleben, nicht der einzige Krisenfall in dieser Frage. Die monogame Ehe aber deswegen aufzugeben oder das Ringen um diese Form abzubrechen, würde dem Evangelium widersprechen. Humane vitae, Sexualität und Empfängnisverhütung Was Paul VI. sagen wollte und was als große Vision richtig bleibt, ist: Wenn man Sexualität und Fruchtbarkeit grundsätzlich voneinander trennt, wie es durch die Anwendung der Pille geschieht, dann wird Sexualität beliebig. Dann sind in der Folge auch alle Arten von Sexualität gleichwertig. Dieser Auffassung, die die Fruchtbarkeit als etwas anderes betrachtet, womöglich so, dass man die Kinder rational produziert und sie nicht mehr als ein natürliches Geschenk sieht, ist ja auch sehr schnell die Gleichbewertung der Homosexualität gefolgt. Die Perspektiven von Humanae vitae bleiben richtig. Nun aber wiederum Wege der Lebbarkeit zu finden, ist etwas anderes. Ich glaube, es wird immer Kerngruppen geben, die sich davon wirklich innerlich überzeugen und erfüllen lassen und dann andere mittragen. Wir sind Sünder. Aber wir sollten es nicht als Instanz gegen die Wahrheit nehmen, wenn diese hohe Moral nicht gelebt wird. Wir sollten versuchen, so viel Gutes zu tun, wie wir können, und einander zu tragen und zu ertragen. Dies alles auch pastoral, theologisch und gedanklich im Kontext der heutigen Sexualforschung und Anthropologie so auszusagen, dass es verständlich wird, das ist eine große Aufgabe, an der gearbeitet wird und an der noch mehr und noch besser gearbeitet werden muss. Der Zölibat: ein Angriff auf das, was der Mensch normal denkt Der Zölibat ist immer ein, sagen wir, Angriff auf das, was der Mensch normal denkt; etwas, das nur realisierbar und glaubhaft ist, wenn es Gott gibt und wenn ich dadurch für das Reich Gottes eintrete. Insofern ist der Zölibat ein Zeichen besonderer Art. Der Skandal, den er auslöst, liegt eben auch darin, dass er zeigt: Es gibt Menschen, die das glauben. Insofern hat dieser Skandal auch seine positive Seite. Homosexualität ist mit dem Priesterberuf nicht vereinbar. Homosexualität ist mit dem Priesterberuf nicht vereinbar. Denn dann hat ja auch der Zölibat als Verzicht keinen Sinn. Es wäre eine große Gefahr, wenn der Zölibat sozusagen zum Anlass würde, Leute, die ohnehin nicht heiraten mögen, ins Priestertum hineinzuführen, weil letztlich auch deren Stellung zu Mann und Frau irgendwie verändert, irritiert ist, und jedenfalls nicht in dieser Schöpfungsrichtung steht, von der wir gesprochen haben. Das Vorgegebene der Liturgie Nicht wir machen etwas, nicht wir zeigen unsere Kreativität, also all das, was wir so machen könnten. Liturgie ist eben keine Show, kein Theater, kein Spektakel, sondern sie lebt vom Anderen her. Das muss auch deutlich werden. Deshalb ist die Vorgegebenheit der kirchlichen Form so wichtig. Diese Form kann im Einzelnen reformiert werden, aber sie ist nicht jeweils durch die Gemeinde produzierbar. Es geht, wie gesagt, nicht um das Selbstproduzieren. Es geht darum, aus sich heraus und über sich hinauszugehen, sich Ihm zu geben und sich von Ihm anrühren zu lassen. Die letzten Dinge Unsere Predigt, unsere Verkündigung ist wirklich einseitig weitgehend auf die Gestaltung einer besseren Welt ausgerichtet, während die wirklich bessere Welt kaum noch erwähnt wird. Hier müssen wir eine Gewissenserforschung machen. Natürlich versucht man, den Hörern entgegenzukommen, ihnen das zu sagen, was in ihrem Horizont liegt. Aber unsere Aufgabe ist gleichzeitig, diesen Horizont aufzusprengen, zu weiten und auf das Letzte hinzuschauen. Diese Dinge sind ein hartes Brot für die Menschen von heute. Sie erscheinen ihnen irreal. Sie möchten stattdessen konkrete Antworten für jetzt, für die Drangsal des Alltags. Aber diese Antworten bleiben halb, wenn sie nicht auch fühlen und inwendig erkennen lassen, dass ich über dieses materielle Leben hinausreiche, dass es das Gericht gibt, und dass es die Gnade gibt und die Ewigkeit. Insofern müssen wir auch neue Worte und Weisen finden, um den Menschen den Durchbruch durch die Schallmauer der Endlichkeit zu ermöglichen. Das Kommen Christi Wichtig ist, dass jede Zeit sich der Nähe des Herrn stellt. Dass gerade auch wir, hier und heute, unter dem Gericht des Herrn stehen und von seinem Gericht her uns richten lassen. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat, während man bis dahin von einem zweimaligen Kommen Christi sprach einmal in Bethlehem, das zweite Mal am Ende der Zeit , von einem adventus medius gesprochen, von einem mittleren Kommen, durch das Er periodisch immer wieder in die Geschichte hereintritt. Ich glaube, damit hat er die richtige Tonart getroffen. Wir können nicht festlegen, wann die Welt zu Ende geht. Christus selbst sagt, niemand weiß es, nicht einmal der Sohn. Wir müssen aber immer sozusagen in der Nähe seines Kommens stehen und vor allem in den Bedrängnissen sicher sein, dass Er nahe ist. Zugleich sollten wir bei unseren eigenen Taten wissen, dass wir unter dem Gericht stehen. Aus eigener Kraft kann der Mensch ohnedies die Geschichte nicht bewältigen. Dass der Mensch gefährdet ist und sich und die Welt gefährdet, wird heute gleichsam auch durch wissenschaftliche Belege sichtbar. Er kann nur gerettet werden, wenn in seinem Herzen die moralischen Kräfte wachsen; Kräfte, die nur aus der Begegnung mit Gott kommen können; Kräfte, die Widerstand leisten. Insofern brauchen wir Ihn, den Anderen, der uns hilft, das zu sein, was wir selbst nicht vermögen; und brauchen wir Christus, der uns zu einer Gemeinschaft versammelt, die wir Kirche nennen. Das Buch des Jahres - Bestellung ab sofort bei kath.net - Auslieferung ab dem 24. November 2010! Benedikt XVI. Alle Bücher und Medien können direkt bei KATH.NET in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Christlicher Medienversand Christoph Hurnaus (Auslieferung Österreich und Deutschland) und dem RAPHAEL Buchversand (Auslieferung Schweiz) bestellt werden. Es werden die anteiligen Portokosten dazugerechnet. Die Bestellungen werden in den jeweiligen Ländern (A, D, CH) aufgegeben, dadurch entstehen nur Inlandsportokosten. Für Bestellungen aus Österreich und Deutschland: [email protected] Für Bestellungen aus der Schweiz: [email protected] Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuBenedikt XVI.
|       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

