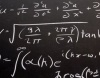SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- ADIOS!
- US-Katholiken mehrheitlich für die Todesstrafe
- Vertrauliche Vorlagen des vatikanischen Konsistoriums sind aufgetaucht
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- Santo subito? - Vatikan untersucht mögliches Wunder durch Benedikt XVI.!
- Brigitte Bardot bedauerte den Verlust des Geheimnisvollen in der Neuen Messe
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- Papst Leo wird die Gründonnerstags-Fußwaschung wieder im Lateran vollziehen
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- THESE: Und die Bibel hat doch Recht!
- L'Avvenire sorgt für Confusione!
- Das Porträt Leos XIV. wird nun in Mosaik-Galerie der Päpste aufgenommen
| 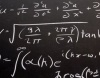
Welche Werte feiert unsere Gesellschaft?5. Juli 2010 in Aktuelles, 10 Lesermeinungen
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Ein russischer Mathematiker lehnt hochdotierte Preise ab und zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Ein Gastkommentar von Adorján F. Kovács.
Linz (kath.net)
Der russische Mathematiker Grigorij Jakowlewitsch Perelman hat den mit einer Million Dollar dotierten Millenium-Preis des US-amerikanischen Clay-Instituts für Mathematik abgelehnt. Der Preis wurde Perelman für die von ihm im Jahre 2002 im Internet publizierte Lösung der sogenannten Poincaré-Vermutung zugesprochen. Perelman hatte zu dieser Zeit noch am Petersburger Steklow-Institut für Mathematik gearbeitet, sich jedoch bereits damals geweigert, an den akademischen Ritualen wie der Verteidigung einer Habilitation oder dem Publizieren in Fachzeitschriften teilzunehmen. Die Voraussetzung für den Millenium-Preis, nämlich die Lösung in einer Fachzeitschrift zu veröffentlichen, erfüllte er deshalb nicht. Insofern waren die Preisverleiher über ihren akademischen Schatten gesprungen - eine echte Seltenheit. Perelman ist der scientific community verdächtig, weil er sich nicht einordnet, aber er ist wohl zu gut, um ignoriert zu werden. Perelman ist Jude und wurde 1966 im damaligen Leningrad geboren. Nach dem Studium der Mathematik konnte er aufgrund von Glasnost und Perestrojka in die Vereinigten Staaten reisen und dort an diversen Instituten als Post-Doktorand arbeiten. Er machte schon vor seiner Arbeit über die Poincaré-Vermutung durch Arbeiten in der Differentialgeometrie auf sich aufmerksam. Diese Arbeiten brachten ihm den Preis für junge Mathematiker der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (EMS-Preis) 1996 ein, den er ablehnte. Nachdem seine Lösung der Poincaré-Vermutung über Jahre hinweg von mehreren Gruppen von Mathematikern überprüft und akzeptiert worden war, wurde Perelman im Jahre 2006 die Fields-Medaille, eine Art Mathematik-Nobelpreis, verliehen, die er ebenfalls ablehnte. Perelman hat 2003 beim Steklow-Institut gekündigt und danach auf der Datsche eines Freundes gelebt und gearbeitet. Er ist zur Zeit im bürgerlichem Sinne arbeitslos und lebt bei seiner Mutter am Stadtrand von Sankt Petersburg. Ganz offenbar ist Perelman ein Mann mit großem Freiheitsbedürfnis, der mit den Zumutungen der akademischen Welt nicht zurechtkommen will. Seine Begründung für die Ablehnung der jüngsten Auszeichnung ist an Fairness und Selbstlosigkeit nicht zu übertreffen: "Der Hauptgrund ist, kurz gesagt, meine Unzufriedenheit mit der Organisation der mathematischen Gesellschaft. Mir gefallen deren Entscheidungen nicht, ich halte sie für ungerecht." Der Beitrag des US-Amerikaners Richard Hamilton bei der Klärung der sogenannten Poincaré-Vermutung sei "um kein bisschen geringer als meiner. Perelman hat bewiesen, dass herausragende Wissenschaft keine Sache sogenannter Forschungsteams und künstlich geschaffener Exzellenzcluster ist, sondern die von genialen Individuen. Er hat ferner gezeigt, dass in der Wissenschaft nicht das Einwerben von Drittmitteln, sondern die Sache wichtig ist. 
In den Meldungen der internationalen Medien zur jüngsten Auszeichnung wird besonders die Höhe des Preisgeldes hervorgehoben. Passend zu unserer üblichen Auffassung von Werten sind nicht der Ruhm und die Ehre, nicht einmal die sachlich-fachliche Anerkennung wichtig, sondern es ist eigentlich das Geld. Die Ablehnung eines solchen Geldpreises ist natürlich immer ein Schlag ins Gesicht all der ökonomisch orientierten Leute, die meinen, mit Geld alles aufrechnen zu können: Anerkannt ist derjenige, der viel Geld hat. Es erscheint allen Kommentatoren vollkommen unverständlich, dass ein moderner Mensch soviel Geld ablehnen kann. Die Fassungslosigkeit äußert sich in Worten wie "Exzentriker" (Handelsblatt), "Einsiedler" (Spiegel), "Kauz" (Bild), "schrullig" (FR). Aber auch hinsichtlich der Gleichgültigkeit Perelmans gegenüber Werten wie Ruhm und Ehre sind die westlichen Menschen ratlos. "Perelman hat die Fields-Medaille abgelehnt, weil er sich von der Gemeinschaft der Mathematiker isoliert fühlt", sagte der Präsident der Internationalen Mathematischen Union, John Ball, der Perelman 2006 eigens besucht hatte, um ihn zur Annahme der Fields-Medaille zu bewegen (und der mit dem Wort "Isolation" unwillkürlich, aber ganz richtig Perelmans Verachtung des akademischen Zirkus umschrieb). "Er hat eine etwas eigene Psychologie, aber das macht ihn auch interessant. Ich fürchte aber nicht um seine geistige Gesundheit." Natürlich, wer Preise und Preisgelder ablehnt, muss ja eigentlich geisteskrank sein. Im Judentum gibt es eine Tradition, die eng mit der Hoffnung auf Erlösung verbunden ist, nämlich die im Volksglauben wurzelnde Vorstellung von den 36 Gerechten, auf denen das Schicksal der Welt ruht. Im Chassidismus hat sich die Vorstellung verbreitet, diese 36 Gerechten lebten in jeder Generation, teils verborgen, teils als Berühmtheiten, teils als Juden, teils unter den Völkern. Gershom Scholem, der grosse Kenner der jüdischen Mystik, erläutert die Bedeutung dieser Gestalten so: «Der verborgene Gerechte, wenn er irgendetwas ist, ist eben dein und mein Nachbar, dessen wahre Natur uns ewig unergründlich bleibt und über den kein moralisches Urteil abzugeben uns diese Vorstellung ermahnen will. Es ist eine von einer etwas anarchischen Moral getragene, aber eben deswegen um so eindrucksvollere Warnung". Der latente Anarchismus Perelmans in Verbindung mit seiner der heutigen Zeit völlig unverständlichen Selbstlosigkeit prädestiniert ihn zu einem dieser Gerechten. Welche Warnung mag wohl von ihm ausgehen? Aber Perelman ist auch Russe. Das Fluidum, in dem er lebt, ist christlich. Das russische Christentum kennt den Starez, den ehelosen Einsiedler, der sich in asketischer Einsamkeit Gott nähert. Auch in seiner äußerlichen Erscheinung - langer Bart, wirre Mähne, eine vorsätzliche Ungepflegtheit - kommt Perelman diesem christlich-russischen Bild, das religiöse Denker wie Tolstoi und Solowjew pflegten, nahe. Wenn Christian Geyer in der "FAZ" bei seiner Forderung nach Aufhebung des Zölibats konstatiert, dass dieses "Zeichen" nur dann noch zeichenhaft bliebe, wenn es überhaupt gesehen würde, offenbart er einen Grundzug unserer Zeit. Freiwillige Ehelosigkeit wird nicht mehr als Askese, sondern als Pathologie wahrgenommen. Ebenso freiwilliger Verzicht auf Ruhm, Ehre und immer wieder Geld, also freiwillige Armut. Sie werden pathologisiert. Die immer wieder aufkommenden Kampagnen für ehrenamtliche unbezahlte Arbeit haben darum heute nur mehr eine zynische Absicht, nämlich billige Arbeitskräfte zu finden, arme Idioten, die noch glauben, ein solcher Einsatz würde heute tatsächlich noch moralisch anerkannt. Aus christlicher Sicht ist die Haltung Perelmans aber auf jeden Fall in hohem Maße anerkennenswert und nachahmenswert, auch wenn das dem aufgeklärten, pragmatischen Zeitgenossen noch so absurd erscheint. Im jüdischen Russen Grigorij Jakowlewitsch Perelman zeigt sich also ein Gegenentwurf zu unserer überordentlichen, übersauberen, überreglementierten materialistischen Welt, die zeitlosen moralischen Standards ratlos gegenübersteht. Das war aber - wie die Vorstellung von den 36 Gerechten zeigt - früher nicht viel anders. Die "Welt" war zwar anders in früheren Zeiten, aber die jüdisch-christlichen Werte haben niemals richtig in die "Welt" gepasst. Sie passen in keine Zeit. Dennoch - oder gerade deshalb - würde es nicht schaden, wenn unsere Medien eine solche Nachricht als das brächten, was sie ist: eine Sensation. Jubelnde Menschen auf dem Siegertreppchen, einen Goldpokal haltend, werden gerne gezeigt, Reichtum feiert sich selbst bei diversen Opernbällen, das ist alles nichts besonderes, aber ein Mensch, der eine absolute Höchstleistung vollbracht hat und dafür keine finanzielle Belohnung will, das ist eine echte mediale Sensation. Scheint aber nicht so schön präsentabel zu sein. Oder machte den Medien zuviel Mühe. Schade. Grigorij Perelman wird wohl einer der verborgenen Gerechten bleiben.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

Lesermeinungen| | Chrysanthus 5. Juli 2010 | |  | Verantwortung. Ja, ein interessanter Artikel.
Kovács schreibt: \"Der latente Anarchismus Perelmans in Verbindung mit seiner der heutigen Zeit völlig unverständlichen Selbstlosigkeit prädestiniert ihn zu einem dieser Gerechten.\" Ich glaube kann, dass jemand so etwas von außen beurteilen kann.
Offensichtlich ist jedoch, dass es für Perelmann wichtiger ist, wie er vor sich da steht als wie er vor der internationalen Öffentlichkeit steht. Und sollte Perelmann ein gläubiger Jude sein (wie der Artikel nahelegt), dann muss man hinzufügen: Perelmann ist es wichtiger, wie er vor Gott da steht.
Dann braucht man nicht so weit zu gehen und an die 36 Gerechten denken. Nach den Lehren Isaak Lurias, von denen die jüdische Spiritualität seit dem 16. Jahrhundert wesentlich geprägt ist, kommt jedem einzelnen Juden, aber auch jedem Heiden (das sind aus jüdischer Sicht alle Nichtjuden) eine unvertretbare Rolle zu bei der Korrektur (hebr. tiqqun) der Welt. Jede Erfüllung einer Mitzwa (eines Gebotes) mit der richtigen Intention (Kawanah) ist eine Teilnahme an der Erlösung der ganzen Welt, allgemeiner (für Heiden): jede gute Tat. Und umgekehrt stärkt jede böse Tat oder auch nur jedes Nachgeben gegenüber den niedrigen Leidenschaften das Böse in der ganzen Welt und verzögert die Erlösung.
Schon von diesem Ansatz her, der sich von der lurianischen Kabbalah auf das ganze orthodoxe Judentum verbreitet hat, kann ein Handeln, wie das von Perelmann, verständlich werden.
Übrigens ist eine solche Spiritualität gar nicht weit entfernt von der katholischen (paulinischen) Lehre von der Miterlöserschaft eines jeden Christen.
Alles Gute und alles Böse, was einer als Christ tut - ob offen oder im geheimen - wirkt sich aus auf den ganzen mystischen Leib Christi und von daher auf die ganze Menschheit und den Kosmos.
Dieser Gedanke kann uns bewusst machen, wie hoch die Verantwortung eines jeden einzelnen von uns ist, an jedem Tag und in jeder Stunde. | 
1
| | | | | Joh. 3, 16 5. Juli 2010 | | | | Zumindest interessant ... dass ausgerechnet eine katholische Nachrichtenagentur das Hohelied des bescheidenen Auftritts singt. Wo doch jede Basilika, jeder Dom, aber auch jedes offizielle Gewand der Geistlichen nach noch mehr Gold und noch mehr Prunk zu schreien scheint ... | 
1
| | | | | Tilly 5. Juli 2010 | | | | Kleine Ergänzung Vor drei Wochen hat Helmut Kohl den hochdotierten deutsch-französischen Medienpreis ohne Angabe von Gründen abgelehnt. | 
1
| | | | | 5. Juli 2010 | | | | Auctoritates Beim heligen Thomas von Aquin spielen nicht nur die Argumente eine Rolle, sondern auch die Autoritäten aus deren Munde sie stammen.
Naturwissenschaftler haben sich gerne darüber lustig gemacht.
Beim Perelman-Beweis der Poincaré-Vermutung spielen die Autoritäten eine Rolle.
Als mir ein Mathemaik-Professor dieses bahnbrechende Ereignis erzählte stellte sich die Frage, ob die Vermutung nun bewiesen sei.
Er konnte nicht antworten. Der Beweis sei hunderte von Seiten lang (heute gibt es Zusammenfassungen auf ein paar dutzend Seiten) und nur die besten Experten für Beweise könnten beurteilen, ob der \"Beweis\" richtig sei .... | 
1
| | | | | Civil Qurage 5. Juli 2010 | | | | Toller Perelmann und sehr schöner Artikel Ein wunderschöner Artikel zu diesem ganz besonderen Menschen. Spricht mir aus der Seele, ich hatte bislang nicht die HG-Info, aber vom Gefühl her ist er für mich so etwas wie einer der Gerechten. Wunderschön geschrieben. Ich habe kein Problem, diesen christlichen Bezug zu sehen und empfinde das Gesagte ganz genau wie der Autor. Danke kath.net für den vielen interessanten Lesestoff. | 
1
| | | | | Donquixote5 5. Juli 2010 | | | | Eine große Lehre für uns alle ! \"Perelman hat bewiesen, dass herausragende Wissenschaft keine Sache sogenannter Forschungsteams und künstlich geschaffener Exzellenzcluster ist, sondern die von genialen Individuen. Er hat ferner gezeigt, dass in der Wissenschaft nicht das Einwerben von Drittmitteln, sondern die Sache wichtig ist.\"
Stimmt zu 100%
http://community.zeit.de/user/donquixote5/beitrag/2010/03/27/grischa-perelman-eine-wichtige-lehre-f%C3%BCr-uns-alle community.zeit.de/user/donquixote5 | 
1
| | | | | Waldi 5. Juli 2010 | | | | Asketische Bescheidenheit von höchster Würde. Der russische Mathematiker Perelman zeigt die Größe des wahren Genies, das sich, unbeeindruckt vom Rascheln der Dollarnoten, mit Demut und Bescheidenheit, allein auf seine gottgegebene Begabung für seine hohe Leistung konzentriert. Auch seine Erkenntnis beindruckt mich, dass große Ereignisse, um zur Welt zu kommen, nie von einem Kollektv, sondern immer von einem genialen Individuum geboren werden. Das zeigt die von Gott gewollte und geadelte Einmaligkeit eines jeden Menschen. | 
2
| | | | | justinusfebronius 5. Juli 2010 | | | | Aha... So, nun habe ich den ganzen Artikel gelesen- aber wo denn nun der christliche Bezug sein soll, verstehe ich nicht gaz. Oder hat er seinen Preisverzicht mit christlichen Argumenten begründet? Und wenn ja: Warum erwähnt der Autor das nicht? Und: Wäre das alles einen Artikel wert, wenn er Forschungsergebnisse vorgelegt hätte, die weniger \"neutral\" sind, als Mathematik, z. B. zur Evolutionstheorie? Wohl kaum ! Also leider eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte... | 
3
| | | | | 5. Juli 2010 | | | | Suche \"sondern\" Die Antwort auf die Frage bleibe ich schuldig,
weil ich nicht \"unsere Gesellschaft\" bin. Nur ein Teil, ein kleiner.
Gegenfrage: Kennt Gott eigentlich das Wort \"sondern\"? Oder kennt Gott vielleicht \"sowohl ... als auch\"?
Perelman hat bewiesen, dass
herausragende Wissenschaft KEINE Sache sogenannter Forschungsteams (+) und künstlich geschaffener Exzellenzcluster (+) IST (für ihn?),
sondern die von genialen Individuen (+) (wie er?).
Er hat ferner gezeigt, dass
in der Wissenschaft NICHT das Einwerben von Drittmitteln (+),
sondern die Sache (+) wichtig IST (für ihn).
Passend zu unserer (Wer ist wir?) üblichen Auffassung von Werten (+) SIND (für uns)
NICHT der Ruhm und die Ehre (+), NICHT einmal die sachlich-fachliche Anerkennung wichtig,
sondern es IST eigentlich das Geld (+) (Alles für uns? Danke).
Freiwillige Ehelosigkeit (+/-)
wird NICHT mehr als Askese (+/-),
sondern als Pathologie (-) wahrgenommen. (Von wem? von C.G.? von unserer Zeit?)
Wenn Ehelosigkeit (-) = Ascese (+)
dann Ehe (+) = Himmel auf Erden (+) | 
1
| | | | | st.michael 5. Juli 2010 | | | | Demut in höchster Potenzierung Ein Bravo für diesen Mann, der die Welt beschämt.
Er steht aber nicht alleine da, sondern stellvertretend für alle stillen Helden und Heldinnen die Großes leisten an denen die Welt aber \"sprachlos\" vorübergeht.
Die große Zahl der Schwätzer, Selbstdarsteller, Dampfplauderer etc. kompensiert nur das eigene Unvermögen mit Lautstärke.
Die drei evangelischen Räte sind: Armut, Keuschheit und Gehorsam !
Wer sich daran hält ist vorne und zwar soweit, das er durch sein Tun den anderen einen moralischen Weg weist.
Aber dieser Weg ist eng und steinig und wird selten wahrgenommen, man ist teilweise sehr einsam.
Ein solcher Mensch ist zum Beispiel auch unser hl.Vater Benedikt XVI.
Möge er noch lange leben, Gott schütze ihn. | 
3
| | |
Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zuWissenschaften- Biotechnologie-Verordnung von US-Präsident Biden als Schritt zum ‚Transhumanismus’?
- US-Abgeordnete: Scharfe Kritik an Forschung mit Körperteilen abgetriebener Babys
- Universität Pittsburgh ist Zentrum für Experimente mit Körperteilen abgetriebener Babys
- Mondlandung bestätigte: "Mensch lebt nicht von Brot allein"
- Alles Zufall, oder was?
- Kutschera übt Selbstkritik ohne seine Thesen zu revidieren
- Theologe Huber: Immer weniger Naturwissenschafter glauben an Gott
- Klimawandel-Hysterie und die Bewahrung der Schöpfung
- DNA-Studie: Alle Menschen stammen von einem Paar ab
- Wissenschaft: Alle Menschen stammen von einem einzigen Menschenpaar ab
| 





Top-15meist-gelesen- ISLAND-REISE - KOMMEN SIE MIT! - Eine Reise, die Sie nie vergessen werden!
- ADIOS!
- Santo subito? - Vatikan untersucht mögliches Wunder durch Benedikt XVI.!
- Vertrauliche Vorlagen des vatikanischen Konsistoriums sind aufgetaucht
- Oktober 2026 - Kommen Sie mit nach SIZILIEN mit Kaplan Johannes Maria Schwarz!
- "Entsprechend klein ist die Lücke, die er hinterlässt"
- „In Deutschland tobt derzeit ein Kirchenkampf“ - Droht ein Schisma?
- Niederländischer Weihbischof Mutsaerts: „Möchte mich nun an liberale Theologen und Gläubige wenden“
- Synodaler Weg führte zu Streit und Verwerfung
- Brigitte Bardot bedauerte den Verlust des Geheimnisvollen in der Neuen Messe
- ‚Dubia‘ an den Vatikan – US-Priester bitten um Klärung hinsichtlich liturgischer Änderungen
- Große kath.net-Leserreise nach Rom - Ostern 2027 - Mit P. Johannes Maria Schwarz
- US-Katholiken mehrheitlich für die Todesstrafe
- Papst sagt Weihbischof für Schweizer Diözese Chur zu
- Hat der Synodale Weg „die katholische Kirche in Deutschland in Machtspiel und Kampfzone verwandelt“?
|