 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
| 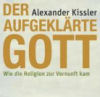 Wie die Religion zur Vernunft kam11. März 2008 in Buchtipp, keine Lesermeinung Christen sollten Stachel sein im Fleisch der Selbstzufriedenen und nicht deren Pausenclown: Alexander Kissler spricht im KATH.NET-Interview über sein Buch "Der aufgeklärte Gott". München (www.kath.net) Alexander Kissler: In der Tat versuche ich die Chancen ausloten, die das Projekt von Papst Benedikt XVI. einer Versöhnung von Glaube und Vernunft im 21. Jahrhundert haben kann. Dazu ist es nötig, sich die verschiedenen Deutungen und Missdeutungen von Vernunft, wie sie heute kursieren, genauer anzuschauen. Der erste Satz des Buches lautet: Nur der Glaube kann die Vernunft zu sich selbst befreien. Der unmittelbare Schreibimpuls war jedoch ein anderer, nämlich das Erstarken der so genannten Neuen Atheisten. Diese Bewegung nehme ich in den Blick, untersuche ihr Denken und ihr Herkommen und frage nach deren Menschenbild. Kann man da von einer Bewegung sprechen? Sind es nicht eher vereinzelte Stimmen, die ihren Religionshass lautstark artikulieren? Ich denke, wir stehen kurz davor, die Religionswerdung des vermeintlich antireligiösen Atheismus zu erleben. Es gibt medial machtvolle Dachorganisationen wie die Giordano-Bruno-Stiftung in Deutschland oder The brights, Die Schlauen, im angelsächsischen Raum. Diesen gelingt es zunehmend, eine Unvereinbarkeit von säkularem, also wissenschaftlichem, und nicht rein säkularem, also transzendenzoffenem, selbstkritischem Denken zu behaupten. Eine solche Auffassung aber ist ein Dogma und gerade keine objektive Aufklärung. Im Manifest des evolutionären Humanismus der Bruno-Stiftung heißt es: Keine der bestehenden Religionen ist mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung noch in Einklang zu bringen. Dahinter steckt eine doppelte Anmaßung: Eine spezielle Form von Wissenschaft, die nur das Experiment als Instanz der Wahrheitsfindung akzeptiert, schwingt sich auf zum Richter über den Wahrheitsgehalt religiöser Einsichten. Und zweitens wird so alle nicht-experimentelle Forschung, werden auch Philosophie und Theologie als unwissenschaftlich denunziert. Wir haben es demnach mit dem breit angelegten Versuch zu tun, etwa die Biologie und die Hirnforschung als neue Allerklärungsdisziplinen, als finale Weltanschauungen zu etablieren? Genau so ist es. Die Biologie und in ihrem Gefolge eine naturalistisch zugespitzte Anthropologie der Mensch bestehe nur aus Materie und Information haben zum Sprung angesetzt, die letzten Bastionen eines naturrechtlichen Denkens zu schleifen. Deshalb gelange ich zum Ergebnis, dass die Vernunft, wie wir sie heute oft erleben, schwach geworden ist, schwächer noch als in den vermeintlich überwundenen voraufklärerischen Jahrhunderten. Sie steckt in jener dogmatischen Krise, aus der sich das verhärtete Christentum der Renaissance mühsam herauswinden musste. Sie ist eng statt weit, doktrinär statt emanzipativ, zerstörend statt aufbauend. Und sie hat derart schlechte Fürsprecher, dass sie keine Gegner mehr braucht. Von wo könnte da Rettung kommen? Eigentlich wäre ein ebenso selbst- wie modernitätskritischer Glaube hierfür prädestiniert. Leider aber zeigt der Glaube sich nicht von seiner besten Seite. Ein Teil der Gläubigen ist ausgewandert zu den religiösen Schnäppchenanbietern, zu Wellness, Tantra und Extremsport. Ein anderer Teil übernimmt von der doktrinär gewordenen Vernunft die Einsicht, im Monolog liege alle Seligkeit. Sie schotten sich ab, werden fundamentalistisch. Ein weiterer Teil der Gläubigen, vermutlich der größte, hat die Forderungen der Welt derart in sich aufgesogen, dass Glaube und Welt kaum mehr zu unterscheiden sind. Christen sind zunehmend versprengten Tataren, die Laut geben, wenn sie betroffen sind, und die dann so reden, wie man eben redet im politischen Alltagsgeschäft. Sie freuen sich, dass man sich für ihre Meinung interessiert, und übersehen, dass man sich eben nur für ihre Meinung, nicht für ihren Glauben interessiert. Verloren gegangen ist weithin das Bewusstsein, dass sie ein Stachel sein sollten im Fleisch der Selbstzufriedenen und nicht deren Pausenclown. Das Christentum muss, denke ich, wieder lernen, was ihm in die Wiege gelegt wurde: die Radikalität der Nachfolge, der Verzicht auf Macht und Ansehen, die Auflehnung gegen allzu viel Beheimatung in dieser Welt. Das Christentum muss sich wieder, um Romano Guardini zu zitieren, als das Nicht-Selbstverständliche bezeugen. Sie haben zuvor ein Buch geschrieben über Benedikt XVI. und dessen schwierige Heimat. Schimmert hier Joseph Ratzingers Kirchenkritik durch? Ein wenig schon. Wichtig ist mir, deutlich zu machen, dass der Glaube da, wo er sich dem experimentellen Wahrheitsbegriff unterordnet, sein Innerstes preisgibt. Diese Bereitschaft ist leider auch in den Kirchen weit verbreitet. Hinzu kommt, dass die Grundannahmen der Neuen Atheisten oft unhinterfragt bleiben. Hier herrscht zuweilen ein bedenklicher Vertrauensvorschuss. Der Verweis auf Vernunft und Wissenschaft wirkt oft wie ein Totschlagargument, das die Debatten beenden soll. Wir sahen das unlängst bei der Auseinandersetzung um das als antisemitisch kritisierte atheistische Kinderbuch Wo bitte gehts zu Gott ?. Dass es nicht auf dem Index landete, wurde von der Bruno-Stiftung als Sieg der Vernunft gewertet. Gleichwohl ist es an der Zeit, nach der Nähe von Atheismus und Judenfeindschaft zu fragen. Es ist kein Zufall, dass Voltaire die Juden verachtete und dass Richard Dawkins den alttestamentlichen Gott einen ekligen Massenmörder nennt. Wer Vernunft und Glaubensferne ineins setzt, für den ist die Geburt des Monotheismus im Judentum die Erbsünde der Menschheit. Eine wichtige Rolle in Ihrem Buch spielt offenbar Gilbert Keith Chesterton. Sie zitieren ihn häufig. Warum? Wenn man Stunde um Stunde atheistische Streitschriften liest, wenn man Ernst Haeckel, Karlheinz Deschner und Michael Schmidt-Salomon zu begreifen versucht, dann braucht man zuweilen ein Gegengift. Chesterton verbindet auf ungewöhnliche Weise Optimismus und Gedankenschärfe, Konfliktfreude und Gelassenheit. Daran fehlt es uns heute auf beiden Seiten. Damit das neue Bündnis von Glaube und Vernunft gelingen kann, damit die unvernünftigen Dogmatiker des religiösen wie des atheistischen Fundamentalismus nicht das letzte Wort haben, brauchen wir vor allem das: Eine Neugier auf jedes neue Wissen und jene Gelassenheit, die die Verwurzelung schenkt in dem, was war. Chesterton besaß beides. Alexander Kissler ist Kulturjournalist und Buchautor. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Für Bestellungen aus Österreich und Deutschland: [email protected] Für Bestellungen aus der Schweiz: Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuGlaube
| 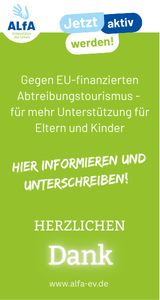       Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
