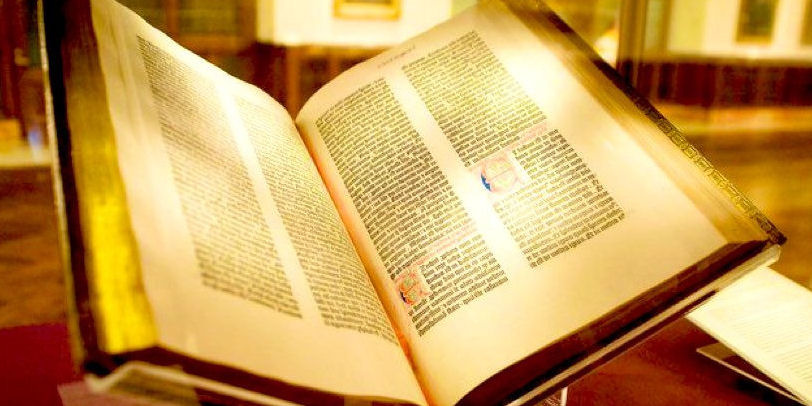
31. März 2021 in Kommentar
„Kann die Bibel, Grundlage unseres Glaubens, nichts als Ablehnung hergeben, wenn wir die Not und das Bemühen homosexueller, bisexueller, polyamorer Menschen betrachten und ihnen pastoral entgegenkommen möchten?“ Gastbeitrag von Bernhard Meuser
Augsburg (kath.net) Wenn es um das Thema Homosexualität geht, scheinen nicht wenige Exegeten einen besonderen Umgang mit der Heiligen Schrift zu pflegen. Sie betreiben Theologie im Wunschmodus. Erwünscht ist, dass die Vielfalt sexueller Selbstverwirklichungen, wie wir sie heute kennen, kompatibilisiert wird mit der Heiligen Schrift. Das Elend ist nur, dass das erwünschte Ergebnis nicht unbedingt mit dem biblischen Stoff korrespondiert. Würde man den Prämissen einer bestimmten Weltanschauung folgen, müsste man in der Heiligen Schrift vielleicht sogar das übelste Stück homophober Literatur sehen, das aus der Antike überliefert ist. Während grosso modo die ganze sie umgebende heidnische Welt homosexuelle Praktiken kannte und sie tolerierte, setzte sich die jüdisch-christliche Tradition von Anfang an und durchgängig durch entschiedene Ablehnung davon ab. In der Bibel taucht kein einziges gleichgeschlechtliches Paar auf. Während es eine hochdifferenzierte Entfaltung der bräutlichen Liebe zwischen Mann und Frau gibt – diese Liebe sogar zum Paradigma des Verhältnisses Gottes zur Welt erhoben wird –, findet sich zu gleichgeschlechtlichen Phänomenen nichts als Zurückweisung. Und das setzt sich fort in der frühchristlichen Tradition, wo die Katechumenen vor die Alternative gestellt werden, „entweder enthaltsam in diesem Stand zu leben oder ´eine Frau nach dem Gesetz zu nehmen´“. (Markschies, Das antike Christentum)
Aber: Kann das denn sein? Kann die Grundlage unseres Glaubens nichts als Ablehnung hergeben, wenn wir die Not und das Bemühen homosexueller, bisexueller, polyamorer Menschen betrachten und ihnen pastoral entgegenkommen möchten? Man kann also den Erwartungsdruck verstehen, der auf der Exegese lastet. Nachdem verschiedene ihrer Exponenten den untauglichen Versuch unternahmen, die einschlägigen biblischen Stellen diametral gegen ihren Wortsinn zu interpretieren, tritt dieser Typus momentan zurück, um einem anderen Platz zu machen. Es ist ja auch schwer vorstellbar, dass eine in lesbischer Beziehung lebende Pastorin Röm 1,26 liest ohne zu erröten oder in einen zweistündigen homiletischen Drahtseilakt zu geraten. Der neue Typus (so zuletzt vertreten von Ulrich Berges) meint, die Schrift habe zur heutigen Gestalt sexueller Selbstverwirklichungen nichts zu sagen, weil hier eine neue Qualität gegeben sei, die seinerzeit einfach nicht bekannt war: „Ein freier Entschluss zwischen gleichberechtigten Männern oder Frauen für eine bleibende, gültige, rechtlich geschlossene Partnerschaft ist dort völlig unbekannt.“ Das sei, so Berges, „historisch bewiesen“, da gebe es „überhaupt keinen Zweifel.“ Das allerdings ist mitnichten so. Nicht nur Ulrich Wilckens, auch N.T. Wright oder Anthony Giambrone OP widersprechen hier entschieden und belegen mit vergleichender Literatur den Kontrastwillen des Christlichen in einer griechischen und römischen Gesellschaft, „in der jede Art von Sexualpraktik, die in der Menschheit jemals bekannt war, ... weit verbreitet war“. (N.T. Wright)
Es steht also auf schwachen Füßen, wenn Ulrich Berges behauptet: „Deshalb kann die Bibel das nicht verbieten, weil sie das gar nicht kennt.“ Die Heilige Schrift kannte auch keinen Straßenverkehr, trotzdem ist der Straßenverkehr heute keine ethikfreie Zone. Man kann durchaus der Meinung sein, dass treue homosexuelle Verbindungen anders zu beurteilen sind als promiskuitive Lebensstile, aber so zu tun, als habe die Schrift uns zum Thema überhaupt nichts zu sagen, das sei alles eine solche nie dagewesene Weltneuheit, davon könne doch kein tempelfrommer biblischer Verfasser etwas geahnt haben – erscheint mir theologisch illegitim. Natürlich muss man zeit- und kulturbedingte Momente in Rechnung stellen, aber die Arbeit der Unterscheidung zwischen Menschenwort und Gotteswort, zwischen menschlichen Eintragungen und göttlicher Offenbarung, wird gerade nicht geleistet, wenn man sich mit einem Trick aus der Haftung nimmt.
Man wird schon sehr nachdenklich, wenn Ulrich Berges sagt: „Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir diese Texte nicht dazu missbrauchen, Traditionen zu zementieren, die in einer freiheitlichen, aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr zu vertreten sind.“ Nicht mehr vertretbar! Ach! Dahin geht also die Reise. Man sollte solche Sätze zweimal lesen. Sie verraten nämlich, welche Hermeneutik hier zur Anwendung kommt. Erst gibt es die Erkenntnishöhe der „freiheitlichen, aufgeklärten Gesellschaft“ – das ist gesetzt, das ist Dogma – und dann scannen wir die Bibel, ob sie zufällig dazu passt. Merkt der Verfasser nicht, dass er seine Wissenschaft instrumentalisieren lässt? Dass sie nicht mehr „Zweck, sondern Mittel“ (John Henry Newman) wird? Merkt er nicht, dass Exegese – indem sie sich zum Erfüllungsgehilfen außerbiblischer Narrative macht – absinkt in ihrem Wissenschaftscharakter? Berges beklagt den Missbrauch biblischer Texte, während er zuvor von Dritten bestimmen lässt, was sie sagen dürfen und was nicht. Da kann man nur Kierkegaard selig anrufen, dass wir noch einmal zurückfinden in die einzig stimmige Relation: „Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dass sie uns kritisiert.“
© 2021 www.kath.net