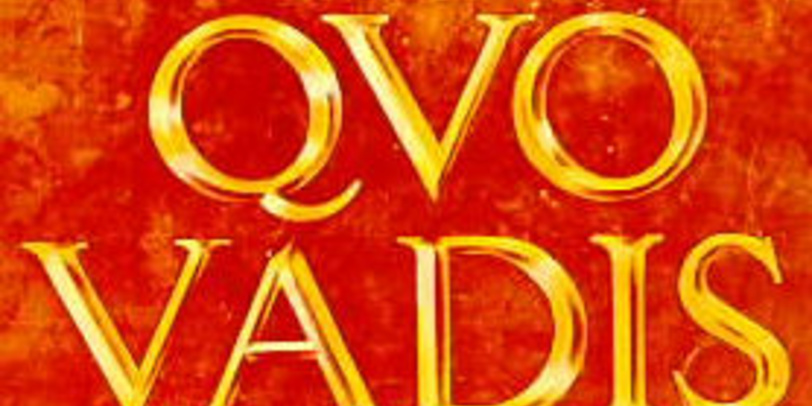
5. April 2013 in Kommentar
In zwei Statements äußern sich der katholische Theologieprofessor Hubert Windisch und der evangelische Oberkirchenrat i.R. Klaus Baschang
Regensburg/Karlsruhe (kath.net/idea) Die ersten Reaktionen auf den neuen Papst sind in der katholischen Kirche weithin geradezu euphorisch und im Protestantismus wie in der bürgerlichen Presse zumindest größtenteils positiv.
Wie geht es nun weiter mit der Ökumene besonders im Blick auf die vielen Vorbereitungen auf das große Reformationsjubiläum 2017, also 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg? Dazu äußern sich ein katholischer Theologieprofessor und ein evangelischer Oberkirchenrat i. R.
Die Schatten der Reformation Ein katholischer Denkanstoß
Von Hubert Windisch
Das Reformationsjubiläum 2017 wirft seine Schatten voraus. Es werden Streit- und Denkschriften verfasst, Forderungen nach kirchlicher Einheit gestellt und ökumenischer Euphorienebel erzeugt.
Um vor allem Letzteren etwas aufzuhellen und eine klarere Sicht auf einige Dinge zu ermöglichen, die gerne verschwiegen werden, möchte ich eine kritische katholische Stellungnahme zur Reformation als solcher abgeben, ohne die historisch gesicherte Mitverantwortung der katholischen Kirche an der Spaltung von damals schmälern und damit eine katholische Selbstrechtfertigung betreiben zu wollen. Es wirft ja nicht nur das bevorstehende Jubiläum seine Schatten voraus, sondern die Reformation wirft seit 1517 ihre Schatten auf die eine Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Mit dieser Aussage seien nicht die wunderbaren und grandiosen Wirkungen der Reformation übergangen, sei es in der reformatorischen Frömmigkeit und dem damit gegebenen Lebenszeugnis bis hin zum Martyrium, sei es in Dichtung und Literatur oder in der Theologie und vor allem in der Musik. Erinnern möchte ich nur an Paul Gerhardt, Johann Sebastian Bach, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer und natürlich an Martin Luther selbst.
Bei diesen Missständen evangelisch werden?
Warum kann bzw. muß man von Schatten der Reformation selbst sprechen? Es sind die dunklen Wirkungen, die auf schattenhafte Ursachen schließen lassen. Gibt es also Fehler, ja sogar Falsches in der augenblicklichen evangelischen Kirche (vor allem in Deutschland, dem Mutterland der Reformation), was auf Defekte im reformatorischen Kirchenansatz zurückschließen lässt?
Einige unbequeme Fragen seien diesbezüglich gestellt: Wie kann ein Vorsitzender der Leitung der EKD, des Rates, den Sühnegedanken in Bezug auf das Kreuz Jesu Christi in Zweifel ziehen oder theologisch-pastorales Wohlwollen für Selbsttötung äußern?
Wie kann eine Präses der Synode der EKD für die volle Anerkennung der sogenannten Homoehe eintreten?
Wie können die Synodalen der EKD einstimmig ein neues Pfarrdienstgesetz beschließen, das schwulen und lesbischen Pfarrern und Pfarrerinnen das Zusammenleben und Wirken in einem evangelischen Pfarrhaus ermöglicht?
Wie kann ein Machwerk, wie es die (feministische) Bibel in gerechter Sprache darstellt, finanziell von verschiedenen Landeskirchen Deutschlands unterstützt und so der Verhöhnung der Heiligen Schrift einem Markenzeichen evangelischen Selbstverständnisses Vorschub geleistet werden?
Es sind gravierende theologische und ethische Defekte, die man aus katholischer Sicht in der evangelischen Kirche feststellen muss und die in mancherlei Hinsicht keinen ökumenischen Konsens mehr erlauben. Da hilft auch die Forderung nach einem gemeinsamen Abendmahl nicht weiter, außer man wollte tiefsitzende Wunden kosmetisch behandeln.
Wo liegen die Ursachen?
Wo liegen die Ursachen? Grundsätzlich wohl darin, dass Luther zwar Reformen wollte, aber letztlich eine Kirchenspaltung herbeiführte, die zu teils 30-fachen, teils 60-fachen, teils 100-fachen Abspaltungen führte.
Das kann nicht dem Willen Jesu entsprechen, der in Johannes 17,20-26 um die Einheit aller, die an ihn glauben, betet. Der Leib Christi (vgl. Epheser 1,23 und Kolosser 1,18) zerfranst, wird amorph, unkenntlich, er wird in die gestalterische Beliebigkeit Einzelner gegeben. Er löst sich auf.
Im Detail könnten aber auch in den berühmten sogenannten vier Alleinstellungsmerkmalen der evangelischen Kirche solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia Schatten verborgen sein, die früher oder später ihre dementsprechenden Auswirkungen zeitigen.
Dem möchte ich im Folgenden in respektvoller Offenheit gegenüber der evangelischen Kirche und in tiefer Wertschätzung gegenüber vielen protestantischen Freunden etwas nachspüren.
Für alle Menschen ist das Heil nur in Christus zu finden
1. Unbestritten ist Jesus Christus allein der heilbringende, sich als Lösegeld hingebende Mittler zwischen Gott und den Menschen (vgl. 1. Timotheus 2,5-6). Niemand kommt zum Vater außer durch ihn (vgl. Johannes 14,6). Er ist die Tür zu den Schafen (vgl. Johannes 10,7), und es ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den sie gerettet werden sollen (vgl. Apostelgeschichte 4,12). In keinem anderen ist also das Heil zu finden außer in Christus (vgl. ebd.). Das gilt natürlich für die Kirche nach außen im Gespräch mit den anderen Religionen ebenso wie für die Glaubenshaltung und Frömmigkeitspraxis im Innern der Kirche selbst.
Haben wir nach außen noch dieses urchristliche Bewusstsein, das in die Heilige Schrift hinein tradiert wurde? Oder haben wir nicht vielmehr dieses Zeugnis nach außen weithin deshalb verloren, weil wir auch den Christusglauben nach innen verloren haben?
Und ging dieser Glaube vielleicht deshalb verloren, weil wir eine andere tiefe verpflichtende Wahrheit des Neuen Testaments verkümmern ließen, dass nämlich nach dem Kirchenvater Cyprian (200 oder 210250) jeder Christ Christus ähnlicher werden soll (vgl. auch Galater 3,27; Epheser 4,24; Römer 13,14)? Ohne diese Wahrheit würde die Kirche als der Leib Christi für den einzelnen Christen Nachfolge-folgenlos. Anders gesagt, das Allein Christus würde zu einer Theorie ohne Wirkung.
Wie anders dagegen der Gedanke, Christus ähnlicher zu werden! Er lässt die Geheiligten, die durch die Taufe an Jesu Kreuz und Auferstehung teilhaben, zu Heiligen werden, mit denen Christus am Ende der Zeit einst wiederkommen wird (vgl. 1. Thessalonicher 3,13)! Jesus Christus inmitten seiner Geheiligt-Heiligen eines der schönsten Bilder von Kirche, das uns die Heilige Schrift schenkt!
Allein Christus ja! Und Christus braucht die Kirche nicht, aber er will sie. Vernachlässige oder zerstöre die Kirche, dann missachtest du Christi Willen.
Die Heilige Schrift ist langsam entstanden
2. Das Allein die Schrift-Prinzip greift allein deshalb schon zu kurz, weil die Heilige Schrift bis hinein in ihre kanonische Festlegung in einem Prozess entstanden ist. Erst auf den Konzilien von Hippo (393) und Karthago (397 und 419) wurde offiziell bestätigt, welche Schriften komplett zum Neuen Testament also zum Kanon gehören.
Das heißt: Die Schrift sollte nicht ohne die Bindung an die Kirche ausgelegt werden. Geschieht das nicht, wird jeder Christ gerne zu seinem eigenen Evangelisten. Und aus Gottes Wort wird Beliebigkeit.
Das II. Vatikanische Konzil betont dagegen in der Offenbarungskonstitution Dei Verbum (Nr. 10), dass es dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut sei, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, immer in dem Bewusstsein, dass die Kirche die Heiligen Schriften verehrt wie den Herrenleib selbst (Nr. 21).
Im Urtext gibt es das Wort allein nicht
3. Im Urtext (Römerbrief 3,21-22) ist das Wörtchen allein in Bezug auf Glaube nicht zu finden .Es einzufügen, ist der Intention des Textes nach verständlich, aber es ist dann keine Übersetzung mehr, sondern Kommentar.
Will man die Absicht Luthers verstehen, muss sie mit seiner Wiederbelebung der paulinischen Rechtfertigungslehre zusammen gesehen werden. Nicht der Mensch aus sich heraus, also aufgrund seiner Werke, wird gerettet, sondern der Mensch, der sich in gläubigem Vertrauen loslässt auf Gott in Jesus Christus hin, der das Heil der sündigen Welt ist. Der Glaube rechtfertigt (vgl. Galater 2,16), nicht die Werke ohne Glauben, aber es ist ein Glaube, der in der Liebe wirksam wird (vgl. Galater 5,6).
Insofern lassen sich Glaube und Werke gar nicht trennen, außer man fördert einen Glauben, der Behauptungen aufstellt, sie aber nicht mit Leben füllt. Die Johannesbriefe und auch der Jakobusbrief zeigen diesen Zusammenhang überdeutlich.
Es geht um den Glauben nicht nur als Gesinnung und Absicht, sondern als Tat. Wer den Glauben an Christus nicht fest stehend in der Heiligen Schrift im Leben konkretisiert, behauptet letztlich, er hätte Glauben, und verfällt trotzdem dem Gericht (vgl. Matthäus 25). Kommen Glaube und Werke nicht in rechter Weise zusammen, dann stimmt die Beziehung zur Heiligen Schrift und zu Jesus Christus nicht.
Und was ist mit Maria?
4. Christus, Schrift und Glaube, alles ist Gnade Gottes. Wenn das Allein die Gnade Luthers freilich richtig verstanden werden soll, kann menschliche Freiheit, die selbst schon Schöpfungsgnade ist, nicht von der Gnade Gottes ausgelöscht oder vernichtet werden. Es geht um Freiheit in Gnade oder, wie Paulus es ausdrückt (Galater 5,1): Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Paulus weiß sehr wohl, dass auch diese Freiheit sündig werden kann. Deshalb seine Mahnung (ebd.): Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!
Es ist ein tief beglückendes Geheimnis, im existenziellen Vollzug des Glaubens zu erfahren, dass durch die Gnade Gottes die eigene menschliche Freiheitsmöglichkeit in einen neuen Freiheitraum hinein befreit wird so sehr, dass man dadurch erst als Mensch ganz bei sich ist und sich doch zugleich ganz von Gott getragen und gehalten weiß. Es ist die Erfahrung der Liebe Gottes im eigenen Leben.
Niemand unter den Menschen durfte diese Erfahrung intensiver machen als Maria, die Mutter des Herrn. Was mit allein die Gnade gemeint ist, kann nur erahnen, wer Maria zu verstehen versucht. Daher kann es keine Einheit unter den Christen geben, wenn nicht auch Maria quer durch die Konfessionen den ihr gebührenden Platz der Verehrung erhält.
Luther sollte entmythologisiert werden
Hilfreich wäre für eine gelingende Durchführung des Jubiläums auch, die Person Martin Luther selbst noch intensiver in den Blick zu nehmen. Luther war ja als Mönch, Priester und späterer Ehemann eine vielschichtige und weitgespannte Persönlichkeit. Bewundernswert ist nicht nur seine sprachliche Kraft, sondern vor allem auch seine Glaubenssehnsucht und Glaubensstärke.
Nachdenklich stimmen dagegen viele fahrlässige Äußerungen zu verschiedensten Anlässen besonders seine scharfe Kritik an den Juden. Es gäbe wahrscheinlich noch viel über ihn zu forschen.
Die evangelische Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte leider aus Luther in gewisser Weise einen Mythos werden lassen.
Eine gesunde Entmythologisierung Martin Luthers täte einer neuen Einheit der Kirche sicher gut, die auf der Basis einer Reformation der evangelischen Kirche auch zu einer geläuterten Katholizität führen könnte.
Der Autor, Hubert Windisch, hatte bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2012 den Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg inne und lebt jetzt bei Regensburg
Die große Chance, evangelisch zu sein Eine protestantische Antwort. Von Klaus Baschang
Das Reformationsjubiläum 2017 bietet der Evangelischen Kirche eine große Chance: Sie kann ihre Grundlagen neu befestigen und ihr Profil wieder schärfen. Verpasst sie diese Chance, wird sie in weitere Bedeutungslosigkeit absinken. Der katholische Denkanstoß ist darum höchst erwünscht und nützlich.
Es muss geklärt werden, was mit dem Jubiläum gewollt wird. Folklore mit Luther-Papierfliegern von Kirchtürmen genügt nicht, ebenso wenig die Etablierung einer Lutherbotschafterin, die über den Reformator als Heiligen und Medienstar redet und ökumenische Gäste begrüßen soll, deren Kirchen die Frauenordination strikt ablehnen.
Sollen diese Gäste mit uns die Kirchenspaltung von damals feiern oder ein interkonfessionelles Bußritual begehen?
Man weiß nicht, was die EKD will. Zumindest müsste sie schon jetzt deutlich widersprechen, wenn von Luthers religiöser Judenpolemik, die zu kritisieren ist, eine Verbindung zum rassistischen und mörderischen Antisemitismus der Nationalsozialisten gezogen wird.
Luther ist kein Denkmal der Vergangenheit, sondern ein Wegweiser in die Zukunft.
Die Rückkehr zu seiner Lehre bietet die nötige Orientierung für die Zukunft unserer Kirche. Luther steht auch der Kirche kritisch gegenüber, die sich auf ihn beruft. Damit stehen die vier Allein der Reformation zur Diskussion. Der katholische Denkanstoß macht diese Aufgabe überdeutlich.
1. Allein Christus
Evangelischer Glaube ist Christusglaube. Darum dürfen evangelische Bischöfe nicht länger missverständlich einsilbig von Gott und vom Monotheismus reden. Der Gott der Bibel ist trinitarisch.
Nur so wird in der unübersichtlich globalen Fülle der Religionen das spezifisch Christliche erkennbar. In der multireligiösen Antike hat die Kirche die Trinitätslehre entfaltet, an ihr durch alle Verfolgungen hindurch festgehalten und so Menschen zum Glauben geführt.
Anpassung an Zeitgeist und Verzicht auf Wahrheit bringen das Evangelium nicht weiter!
Der Christusglaube muss zudem als Christusfrömmigkeit praktisch werden. Darum hat die Evangelische Kirche Pietismus und Erweckungsbewegung in ihrer Mitte zu respektieren, auch wenn sie deren Programme nicht total übernimmt; sie hat sich vor sie zu stellen, wenn sie angegriffen werden.
Das Allerweltswort Spiritualität darf nicht länger den spezifischen Begriff Frömmigkeit verdrängen.
Zur Christusfrömmigkeit gehört die Kirche als der Leib Christi. Die Kirche steht für Christus in der Welt. An diesem missionarischen Auftrag hat sich ihre Organisationsform und Arbeitsweise auszurichten.
Da mögen dann auch demokratische Verfahren zweckmäßig sein. Aber Demokratie im Sinne von Volksherrschaft ist nicht das Wesen der Kirche, deren Herr Christus ist.
2. Allein die Bibel
Evangelischer Glaube ist Bibelglaube. Die Bibel legt sich selbst aus. Darum darf es keine Autorität oberhalb der Bibel geben, die das Verstehen der Bibel steuern will. So haben die Reformatoren geglaubt und gelehrt.
Aber die Differenzierung und Pluralisierung des gesellschaftlichen Lebens erfasst auch die Landeskirchen. Seit sie ihre Beziehungen zum Staat gelockert haben, sind sie auch religiös nicht mehr stabil. Die Grenzen zwischen ihnen und den Freikirchen und unabhängigen Gemeinden sind fließend geworden. Sekten haben in den Zwischenräumen leichtes Spiel.
Wenn sich der Protestantismus treu bleiben und der Lehrautorität des Papstes nicht unterwerfen will, braucht er Auslegungshilfen, die die Wahrheit bewahren. Das sind die Bekenntnisse. Sie sind in Verfolgungszeiten entstanden und haben geholfen, diese zu bestehen. Die Kirchenverfassungen gründen auf ihnen, die Amtsträger werden auf sie verpflichtet. Wenn sie weiter vernachlässigt werden, wird noch mehr unübersichtliche Verwirrung bei uns Evangelischen einziehen.
Der Trend aus den Landeskirchen heraus ist auch eine Reaktion darauf, dass mancher Kirchenführer in Sachen Schriftauslegung einen Wahrheitsanspruch für sich in Anspruch nimmt, wie ihn der Bischof von Rom nicht vertritt!
Natürlich steht die Lehre vom Sühnopfertod Jesu gegen den Zeitgeist. Aber die Theologen haben dazu studiert, dass sie die Bibel vernünftig erklären können und nicht Unpassendes einfach rauswerfen.
Und es darf doch niemand dem Apostel Paulus die Lehrerlaubnis entziehen wollen, nur weil wir mit seiner Wertung der Homosexualität in Römer 1,24ff nicht gleich zurechtkommen.
3. Allein der Glaube
Evangelischer Glaube ist Rechtfertigungsglaube. Hier schlägt das Herz der Bibel. Der Mensch ist in seiner Abwendung von Gott ein Sünder und wird zugleich von Gott gerecht gemacht durch das Opfer Christi am Kreuz.
Dieses dialektische Menschenbild ist das genaue Gegenstück zur Gutmenschenideologie. Nur damit wird die Evangelische Kirche anschlussfähig an die komplexen Gegenwartsfragen. Seine Verleugnung macht den Protestantismus zu einer lauwarmen Ausgabe des Christentums (der Philosoph Jürgen Habermas).
Es ist darum falsch, in der Glaubensfrage alles auf die blinde Zustimmung zu historischen Behauptungen zu setzen, die keinen persönlichen Bezug zur Existenz der Glaubenden haben. Ebenso ist es falsch, die Wahrheit des Glaubens durch politische Programme demonstrieren zu wollen, die unübersetzt aus der Bibel abgerufen werden, Beifall finden, aber nicht zum Nachdenken veranlassen.
Dem Glauben steht die Anfechtung gegenüber. Sie reicht tiefer als das Burn-out, um das sich die Kirche neuerdings kümmert. Anfechtung ist nicht Selbstzweifel, sondern Zweifel an Gott.
Wenn diese Erfahrung in der Kirche nicht zur Sprache kommt, dann ist ihre Verkündigung harmlos.
4. Allein die Gnade
Evangelischer Glaube ist Gnadenglaube. Allein die Gnade Gottes bewahrt den Glauben davor, ein frommes Werk zu werden. Auch mit Frömmigkeit lässt sich Gott nicht imponieren. Luther: Die Liebe Gottes findet ihren Gegenstand nicht vor, sondern schafft ihn sich. Die Liebe des Menschen entsteht an ihrem Gegenstand (so festgehalten in der Heidelberger Disputation von 1518, Nr. 28). Im Neuen Testament heißt das der neue Mensch.
Diese Gnadengabe muss im Glaubenden sichtbare Gestalt bekommen, auch wenn das immer nur vorläufig und bruchstückhaft möglich ist.
Die Gnadengabe ist der Wurzelgrund der Glaubensfreiheit. Sie darf aber nicht mit ethischer Gleichgültigkeit verwechselt werden. Die Glaubensfreiheit verpflichtet zum Gehorsam der Liebe. Die Liebe kann sogar Lebensweisen von Minderheiten Raum in der Kirche gewähren, sofern durch sie die Gemeinschaft in der Kirche nicht provokativ gestört wird. Solche Lebensweisen von Minderheiten, also etwa homosexueller Mitchristen, dürfen aber nie zu einer allgemeingültigen Ethik für alle erhoben werden. Denn dann wird die Freiheit der Glaubenden bedroht.
Die Freiheit des Glaubens ist allen historischen und politisch verheißenen Freiheitserfahrungen immer voraus. Darum geht es nicht, das Reformationsgeschehen auf die Freiheitsfrage zu reduzieren. Dabei wird übersehen, dass die Freiheit, die von Gott gelöst und sich selbst überlassen ist, sich selbst zerstört.
So könnte Ökumene gelingen!
Der Denkanstoß nötigt die Evangelische Kirche zu einer fundamentalen Selbstbesinnung. Sie kann ihre Probleme nicht dadurch lösen wollen, dass sie sich an die römisch-katholische Kirche anlehnt oder ihr permanent widerspricht.
Umgekehrt gilt dasselbe. Die römisch-katholische Kirche kann ihre Probleme nicht mit Hilfe der evangelischen lösen.
Es steht nicht zu erwarten und darf auch nicht gewünscht werden, dass der Papst den Selbstanspruch seines Amtes aufgibt. Es ist aber auch nicht zu erstreben, dass die nicht-katholische Christenheit unter eine Art Schutzschild von Rom kriecht.
Das Rad der Geschichte kann man nicht zurückdrehen. Kirchengeschichte ist immer auch Glaubensgeschichte. Wir sollten endlich glauben lernen, dass Gottes Geist in ihr wirksam ist.
Nicht mehr von Spaltung sollte jetzt die Rede sein, sondern von kreativer Pluralität, von missionarischer Vielfalt. Spaltung verdeckt, was die Kirchen inzwischen (wieder) gemeinsam haben: Bibel, Taufe, altkirchliche Bekenntnisse, gemeinsamer Wortlaut des Vaterunser und des Apostolicum, Konsens in der Rechtfertigungslehre (!), Bibellesepläne, Choräle, soziale Arbeit usw. In dieser Perspektive stehen dann in der globalen Christenheit unterschiedliche Kirchentypen in gemeinsamer Verantwortung für das Evangelium. Sie sind in einigen Besonderheiten ihrer Lehre und in ihren Organisationsformen unterschiedlich ausgeprägt und glauben dieses gerade als Reichtum im Reiche Gottes und stellen es öffentlich für Jesus werbend so dar. Auch dann wird es nicht ohne Spannungen abgehen, vor allem aber nicht ohne das Wíssen darum, dass das Reich Christi jeder Kirchengestalt immer voraus ist.
Der Autor, Klaus Baschang (Karlsruhe), ist Oberkirchenrat i. R. der Evangelischen Landeskirche in Baden
© 2013 www.kath.net