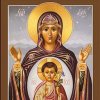
9. Dezember 2006 in Weltkirche
Provokation für das moderne Bewusstsein: Warum kaum eine christliche Lehre plausibler erscheint als die von der Erbsünde - Von Robert Spaemann / Die Tagespost.
Würzburg (www.kath.net/Die-Tagespost.de)
Für uns Menschen und zu unserer Rettung ist er vom Himmel herabgestiegen, so sprechen wir im Credo der Messe. Hic genuflectitur, hier kniet man nieder sagt die Rubrik im alten Missale. Warum braucht der Mensch Rettung? Die Antwort der Kirche lautet: weil die Menschheit verloren hat, was sie braucht, um den Sinn ihrer Existenz zu erfüllen. Nichts würde es uns nützen geboren zu werden, wenn wir nicht wiedergeboren würden, singt die Kirche in der Osternacht. So ähnlich hat es Jesus zu Nikodemus gesagt. Wie kann es sein, dass ein natürliches Wesen nicht von Natur mit dem ausgestattet ist, was es braucht, um den Sinn seines Lebens zu verwirklichen?
Die Antwort des Katechismus lautet: schuld ist die Erbsünde. Der Mensch ist nicht in der Verfassung, in der er sein sollte. Es ist eine Sünde unserer Urahnen, die uns in diesen defizitären Zustand gebracht hat, aus dem wir uns selbst nicht befreien können. Die Lehre der Erbsünde wird heute von manchen katholischen Theologen verworfen. Sie soll ein von Augustinus inspirierter Irrweg und für uns nicht mehr nachvollziehbar sein. Verschwiegen wird dabei oft, dass es sich um Canones des Trienter Konzils handelt, deren Leugner sich aus der katholischen Kirche ausschließen. Auch weiß ich nicht, wie man eigentlich die überwältigenden Zeugnisse der Heiligen Schrift weginterpretieren will, also zum Beispiel den Psalm Miserere mit seinem Vers: Denn siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünden hat meine Mutter mich empfangen. Oder die Stelle im Römerbrief, wo es heißt: Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und: durch die Verfehlung des einen Menschen kam über alle Menschen die Verdammung und wie die Vielen durch den Ungehorsam des einen zu Sündern wurden, so werden sie durch den Gehorsam des Einen als Gerechte wieder hergestellt. Es gehört schon eine große Kunst dazu, diese Zeugnisse durch Interpretation zum Schweigen zu bringen.
Aber dafür muss es Gründe geben. Mir scheint zwar, dass es kaum eine christliche Lehre gibt, die plausibler ist als die Erbsündenlehre. Denn wenn wir voraussetzen, dass Gott gut und allmächtig ist und wenn wir die Bosheit mancher Menschen und die Schwäche und Versuchbarkeit der meisten Menschen betrachten, dann ist die Lehre von der Erbsünde die einzige einleuchtende Erklärung. Dennoch bereitet sie offenbar vielen Menschen Schwierigkeiten. Sie fordert den modernen common sense in mehrfacher Weise heraus. Der common sense ist geneigt, die durchschnittliche Befindlichkeit des Menschen als Resultat der Evolution zu betrachten, das mit irgendeiner Schuld nichts zu tun hat. Dem modernen Bewusstsein geht es andererseits schwer ein, dass Heiligkeit und Unheiligkeit des Menschen irgendetwas zu tun haben sollten mit biologischer Vererbung. Eher würde man einen Ansteckungszusammenhang akzeptieren. Aber das Trienter Konzil hat es als Dogma gelehrt, dass die Erbschuld durch Zeugung, nicht durch Nachahmung weitergegeben wird. Schließlich leuchtet es dem modernen Individualismus ebenso schwer ein, dass jemand in einen nicht selbst verursachten Schuldzusammenhang vor Gott verstrickt ist, wie dass er durch den Gehorsam eines anderen bis zum Tod diesem Zusammenhang entrissen wird.
Der Stellvertretungsgedanke gehört zu den provokativsten und zugleich zu den tröstlichsten Lehren des Christentums. Kierkegaard hat in der Lehre, dass in Adam alle gesündigt haben, eine Chiffre für die Tatsache gesehen, dass jeder Mensch auf die gleiche Weise die Unschuld verliert. Aber diese Theorie führt in ein Dilemma. Entweder jeder Mensch ist frei. Dann kann niemand wissen, ob wirklich alle die Unschuld verlieren. Oder aber man kann es wissen. Aber dann nur aufgrund der menschlichen Natur, zu der es gehört, die Unschuld zu verlieren. Wenn das aber der Fall ist, dann handelt es sich nicht wirklich um Schuld, denn wir haben unsere Natur nicht selbst gemacht. Kierkegaard steht hier noch in der Tradition des deutschen Idealismus, dessen Deutung des Sündenfalls wiederum auf Rousseau zurückgeht. Der Sündenfall wird hier zu einer anthropologischen Notwendigkeit. Erst im Akt des Ungehorsams gegen das göttliche Gebot wird der Mensch sich seiner Freiheit bewusst. Der Sündenfall ist die Emanzipation, das Heraustreten des Menschen aus der Natur, die Subjektwerdung des Menschen.
Aber diese Deutung verfehlt die Pointe der Paradieserzählung. Thomas von Aquin trifft diese Pointe meines Erachtens sehr viel besser. Er fragt, warum Gott dem Menschen verboten hat, von dem Paradiesbaum zu essen. Seine Antwort: der Mensch sollte in einer einzigen Sache etwas tun aus dem einzigen Grund, weil Gott es geboten hat. Der paradiesische Mensch kennt kein Sittengesetz. Er will und tut das Rechte, weil es das Natürliche und so ihm selbst natürlich ist. Gott will ihn aber zu einer übernatürlichen Freundschaft mit ihm, Gott, aus dem bloß Natürlichen herausrufen. Das hat Rousseau ganz richtig gesehen. Der Mensch soll einen Schritt über seine evolutionäre Natur hinaustun in ein personales Reich Gottes. Aber dieser Schritt über die natürliche Unschuld hinaus geschieht schon dadurch, dass der Mensch ein göttliches Gebot erfährt und nicht erst dadurch, dass er es übertritt. Im Gegenteil: durch den Akt freien Gehorsams hätte sich der Mensch wirklich vom Zwang der Natur emanzipiert. Indem er der Versuchung zum Zugreifen erliegt, bleibt er in diesem Zwang, aber nun nicht mehr unschuldig, denn er hätte auch anders gekonnt. Das freiwillige Bleiben im natürlichen Egozentrismus wird zum schuldhaften Egoismus. Nun bedarf der Mensch der Erlösung.
Es bleibt die Frage, wie wir die Vererbung dieser Schuld zu denken haben. Kann ein spiritueller Makel durch Zeugung weitertransportiert werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir fragen, worin dieser Makel besteht. Er besteht einfach im Ausbleiben von etwas, das durch das Hineingezeugt- und geborenwerden in das Menschengeschlecht weitergegeben werden sollte, der Heiligkeit des Gottesvolkes. Sie wird nun nicht weitergegeben, weil sie gar nicht zustande gekommen ist. Wer war denn Adam? Paulus nennt Jesus Christus den neuen Adam. Was heißt das? Es heißt, Jesus ist das, was Adam sein sollte: Vater einer Menschheitsfamilie unter Gott, eines Volkes Gottes, eines heiligen Volkes, in das jeder spätere Mensch hineingeboren wird. Dieses Menschheitsvolk kam nicht zustande, und der Versuch, es durch eine gemeinsame Großaktion, den babylonischen Turmbau ohne Gott, also als Kirche von unten selbst herzustellen, scheitert. Der neuen Anlauf von oben ist die Berufung Abrahams zum Vater eines Gottesvolkes, in das man auch hineingeboren wird, Jude ist, wer Kind einer jüdischen Mutter ist das aber noch nicht eine universale Menschheitsfamilie ist, sondern diese nur vorbereitet: In deinem Samen werden alle Völker der Erde gesegnet werden.
Die Menschheit ist nicht Volk Gottes. Wer in sie hineingeboren wird, ist nicht heilig von Geburt. Einst wart ihr kein Volk. Jetzt seit ihr Volk Gottes, schreibt Petrus an die Heidenchristen. Erbsünde, das heißt: der Mensch bleibt zwar aufgrund seiner geistigen Natur hingeordnet auf einen göttlichen Grund jenseits aller Natur und auf eine Gemeinschaft, die die Natur transzendiert. Aber das Menschengeschlecht, in das wir hineingeboren werden, ist nicht diese Gemeinschaft, es ist kein heiliges Volk, und wir sind durch die Zugehörigkeit zu ihm nicht heilig. Um zu unserer Bestimmung zu gelangen, müssen wir, wie Christus sagt, wiedergeboren werden, und zwar nicht aus dem Wollen des Mannes oder dem Wollen des Fleisches, sondern aus Gott, wie es im Prolog des Johannesevangeliums heißt.
Die Taufe ist die Geburt durch die Kirche und in das neue Volk Gottes hinein. Sie steht allen Menschen offen. Durch sie wird die Erbsünde, also der Zustand der Gottferne aufgehoben. Nicht freilich die Folgen der Erbsünde, die oft mit der Erbsünde verwechselt werden. Wenn Kranke zu Jesus gebracht wurden, sagte er oft als erstes: Deine Sünden sind Dir vergeben, und erst dann Nimm dein Bett und geh nach Hause. Es besteht also offenbar ein Zusammenhang zwischen Erbsünde und Krankheit, aber nicht so, dass die Tilgung der Sünde die körperliche Heilung zur automatischen Folge hat. Das Wesen der Erbsünde ist das Fehlen der Freundschaft mit Gott, die Wiedergeburt ist die Aufnahme in das heilige Volk Gottes, das der heilige Paulus auch den Leib Christi nennt.
Die Folgen der Erbsünde verhalten sich zu dieser selbst wie die Folgen einer schweren Krankheit, die die Krankheit selbst oft überdauern. Der geheilte Alkoholiker bleibt anfällig für die Versuchung und muss, um nicht rückfällig zu werden, völlige Abstinenz üben, wozu der Gesunde keinen Grund hat. Die Menschen, deren Natur durch die Erbsünde geschwächt ist, müssen sich unter Umständen Gewalt antun, um Sünden zu meiden, was für den paradiesischen Menschen und für die Gottesmutter nicht notwendig war. Außerdem wird ein Mensch, dem ein von ihm Geschädigter verziehen hat, schon aus Dankbarkeit für die wiederhergestellte Freundschaft alles tun, um den Schaden wieder gut zu machen. Und das gilt auch für den Schaden, der durch jedes Unrecht dem Gemeinwesen zugefügt wird, eine Wiedergutmachung, die wir Sühne nennen. Die Verzeihung Gottes geht freilich allen unseren Wiedergutmachungen voraus. Aber auch diese kann nicht unter Verletzung der Gerechtigkeit geschehen, denn Gott ist die absolute Gerechtigkeit ebenso wie er die absolute Barmherzigkeit ist. Nil inultum remanebit, heißt es im Dies irae, nichts bleibt ungerächt. Die Antinomie, die sich daraus ergibt, scheint auf eine Quadratur des Zirkels hinaus zu laufen. Diese Quadratur des Zirkels ist der Kreuzestod des Gottessohnes, den die Menschen und nicht Gott inszeniert haben, den aber Gott zu dem Ereignis gemacht hat, das die Welt erlöst stellvertretend. Die Möglichkeit der Stellvertretung gehört zu den Mysterien des Christentums, die für das moderne Bewusstsein schwer anzueignen sind. Aber unsere ganze Hoffnung hängt daran.
© 2006 www.kath.net