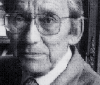
17. Juni 2005 in Interview
Der Philosoph Carlos Díaz über den berühmten französischen Philosophen Paul Ricoeur, der am 20. Mai starb.
Rom (www.kath.net / zenit) Vor knapp einem Monat, am 20. Mai, starb Paul Ricoeur, einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts, in seinem Haus in Châtenay Malabry (Paris). Der Tod des 92-jährigen Franzosen war so, wie es sich dieser immer erhofft hatte: im eigenen Haus und nicht im Krankenhaus, ohne großer Leiden und ohne Verlust des Gedächtnisses. Das Begräbnis wurde seinem Wunsch gemäß völlig diskret in seiner protestantischen Pfarre abgehalten.
Carlos Díaz, Gründer des Mounier-Instituts und Professor für Religionsphänomenologie an der Madrider Universität Complutense, geht im Gespräch mit ZENIT auf die Persönlichkeit und das Denken von Paul Ricouer ein, mit dessen Tod die Christenheit eine der einflussreichsten Stimmen in der heutigen philosophischen Welt verloren habe.
Im Juli 2003 zeichnete Papst Johannes Paul II. den Philosophen mit dem "Internationalen Preis Paul VI." aus. Seine Forschungen hätten gezeigt, "wie fruchtbar die Verbindung zwischen Philosophie und Theologie, zwischen Glauben und Kultur sind", sagte der am 2. April verstorbene Vorgänger von Benedikt XVI. damals.
ZENIT: Was verliert die Welt mit Paul Ricoeur?
Díaz: Mit dem Tod Paul Ricoeurs verstummt eine der letzten christlichen Stimmen von ungemeiner Tragweite und eine anerkannte Autorität der heutigen philosophischen Welt. Diese große Annahme erklärt sich aus dem hermeneutischen Charakter seines Denkens: Es öffnet sich allen Systemen und verwendet von ihnen das Beste. Dadurch ergibt sich natürlich auch eine gewisse Ungenauigkeit, das heißt, eine gewisse Tendenz, "nicht Recht haben zu wollen". Diese Art, Probleme anzugehen, wird vom zeitgenössischen Denken viel eher begrüßt als wenn man die Probleme offen und entschieden anginge.
ZENIT: Woran wird man sein Erbe erkennen und wer wird es fortführen?
Díaz: Aus dem zuvor Gesagten wird klar, dass sein Erbe nicht einige bestimmte Philosophen fortführen werden. Man wird sich an ihn vielmehr als einen sehr liebenswürdigen und freundlichen Denker erinnern. Nirgendwo wird er mit besonders hervorstechenden Aussagen aufscheinen. Dass Ricoeur zu den ganz großen Philosophen des jetzigen Augenblicks gehört hat, bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass er in die Philosophiegeschichte eingehen wird. Den Fachleuten wird er natürlich ein Begriff sein. Warum das so ist, liegt glaube ich daran, dass Ricoeur eher analytisch veranlagt war, nicht so sehr etwas vorschlagen wollte.
ZENIT: Welcher Aspekt von Ricoeur fasziniert Sie am meisten?
Díaz: Zuallererst seine außerordentlich treue Freundschaft zu seinem Lehrer Emmanuel Mounier, vor dem er einen bewundernswerten Respekt gehabt hat. Im Menschlichen haben mich besonders seine Güte und seine Feinfühligkeit tief beeindruckt. Sie ließen einen gewissen Hang zum Humor erkennen, der aber nicht bissig oder scharf war. Und dann ist da noch seine große Demut, die ich sogar Zärtlichkeit nennen würde. Sie befähigte ihn dazu, mit jedem ins Gespräch zu kommen, sogar mit den größten Angebern, die nichts wissen. In intellektueller Hinsicht verblüfft mich bei Ricoeur die Fähigkeit, jeden Autor in jeder beliebigen Sprache zu verstehen. Seine Intelligenz, dank der er die verschiedenen Probleme analytisch zerlegte, scheint mir fast unerreicht.
ZENIT: Bleiben wir als Waisenkinder zurück, wenn so große christliche Denker wie Ricoeur von uns gehen?
Díaz: Nein, keineswegs. Zum einen deshalb, weil sein Beitrag zum Christentum als solcher nicht besonders thematisch gewesen ist. Zum anderen aber auch deshalb, weil man doch sicher hoffen kann, dass viele Christen sehen, wie notwendig mehr Theologen sind, nämlich Menschen, die über den Herrn nachdenken und dabei ihren Kopf an seine Seite legen.
© 2005 www.kath.net